Weblog von Beat Döbeli Honegger
Dies ist der private Weblog von Beat Döbeli Honegger
Categories
- 74 Annoyance
- 121 Biblionetz
- 7 Bildschirme
- 8 Bildungspolitik
- 8 DPM
- 11 Digital Immigrants
- 3 Elektromobil
- 14 GMLS
- 64 Gadget
- 53 Geek
- 7 GeoLocation
- 14 HandheldInSchool
- 106 Informatik
- 25 Information-Architecture (IA)
- 11 Kid
- 78 Medienbericht
- 133 Medienbildung
- 6 Modelle
- 30 OLPC
- 49 PH Solothurn
- 35 PHSZ
- 4 RechtUndInformatik
- 154 Schul-ICT
- 20 Scratch
- 7 SecondLife
- 105 Software
- 52 Tablet-PC
- 144 Veranstaltung
- 15 Video
- 61 Visualisierung
- 124 Wiki
- 19 Wissenschaft
- 6 Zeitschrift c't
Archive
- 4Dec 2025
- 2Nov 2025
- 2Oct 2025
- 2Sep 2025
- 1Aug 2025
- 4Jul 2025
- 1Jun 2025
- 5May 2025
- 5Sep 2024
- 1Aug 2024
- 2Jul 2024
- 1Jan 2024
- 1Dec 2023
- 1Sep 2023
- 2Jul 2023
- 1Jun 2023
- 1Mar 2023
- 1Feb 2023
- 1Jan 2023
- 1Jul 2022
- 1Jan 2022
- 1Oct 2021
- 1Sep 2021
- 1Jun 2021
- 2Apr 2021
- 1Feb 2021
- 1Nov 2020
- 3Sep 2020
- 2Jun 2020
- 1May 2020
- 1Apr 2020
- 2Mar 2020
- 1Feb 2020
- 2Jan 2020
- 1Dec 2019
- 1Nov 2019
- 1Oct 2019
- 4Sep 2019
- 1Jul 2019
- 1Jun 2019
- 3Apr 2019
- 1Mar 2019
- 3Jan 2019
- 1Dec 2018
- 1Nov 2018
- 1Oct 2018
- 1Aug 2018
- 4Jun 2018
- 2Dec 2017
- 3Nov 2017
- 2Oct 2017
- 5Sep 2017
- 4Jul 2017
- 1Jun 2017
- 1Apr 2017
- 1Jan 2017
- 3Dec 2016
- 3Nov 2016
- 1Oct 2016
- 3Sep 2016
- 1Aug 2016
- 1Jun 2016
- 3May 2016
- 4Apr 2016
- 3Mar 2016
- 4Jan 2016
- 3Dec 2015
- 3Nov 2015
- 2Oct 2015
- 3Sep 2015
- 4Aug 2015
- 3Jul 2015
- 5Jun 2015
- 8May 2015
- 5Apr 2015
- 6Mar 2015
- 5Feb 2015
- 6Jan 2015
- 6Dec 2014
- 10Nov 2014
- 5Oct 2014
- 9Sep 2014
- 3Aug 2014
- 3Jul 2014
- 6Jun 2014
- 4May 2014
- 8Apr 2014
- 6Mar 2014
- 5Feb 2014
- 4Jan 2014
- 6Dec 2013
- 7Nov 2013
- 15Oct 2013
- 4Sep 2013
- 8Aug 2013
- 7Jul 2013
- 13Jun 2013
- 5May 2013
- 5Apr 2013
- 8Mar 2013
- 4Feb 2013
- 10Jan 2013
- 9Dec 2012
- 7Nov 2012
- 10Oct 2012
- 7Sep 2012
- 8Aug 2012
- 7Jul 2012
- 4Jun 2012
- 3May 2012
- 9Apr 2012
- 9Mar 2012
- 1Feb 2012
- 6Jan 2012
- 9Dec 2011
- 3Nov 2011
- 10Oct 2011
- 13Sep 2011
- 4Aug 2011
- 8Jul 2011
- 7Jun 2011
- 8May 2011
- 7Apr 2011
- 4Mar 2011
- 3Feb 2011
- 7Jan 2011
- 7Dec 2010
- 10Nov 2010
- 11Oct 2010
- 9Sep 2010
- 6Aug 2010
- 6Jul 2010
- 2Jun 2010
- 6May 2010
- 8Apr 2010
- 7Mar 2010
- 8Feb 2010
- 10Jan 2010
- 6Dec 2009
- 11Nov 2009
- 8Oct 2009
- 14Sep 2009
- 7Aug 2009
- 11Jul 2009
- 5Jun 2009
- 14May 2009
- 21Apr 2009
- 14Mar 2009
- 20Feb 2009
- 14Jan 2009
- 9Dec 2008
- 14Nov 2008
- 9Oct 2008
- 11Sep 2008
- 15Aug 2008
- 9Jul 2008
- 8Jun 2008
- 14May 2008
- 15Apr 2008
- 14Mar 2008
- 19Feb 2008
- 18Jan 2008
- 17Dec 2007
- 16Nov 2007
- 25Oct 2007
- 10Sep 2007
- 27Aug 2007
- 16Jul 2007
- 27Jun 2007
- 31May 2007
- 28Apr 2007
- 12Mar 2007
- 34Feb 2007
- 31Jan 2007
- 29Dec 2006
- 33Nov 2006
- 20Oct 2006
- 35Sep 2006
- 42Aug 2006
- 35Jul 2006
- 31Jun 2006
- 29May 2006
- 23Apr 2006
- 20Mar 2006
- 23Feb 2006
- 43Jan 2006
- 26Dec 2005
- 31Nov 2005
- 31Oct 2005
- 14Sep 2005
- 31Aug 2005
- 24Jul 2005
- 1Jul 2004
You are here: Weblog von Beat Döbeli Honegger
Angefangen echt störend zu werden hat der Telefon-Spam bei mir 2007, also vor fünf Jahren (siehe SPITistDa). Seither das Ausmass weiterhin zu, 2011 musste ich einen ersten manuellen Spamfilter auf meiner Telefonzentrale installieren, um noch in Ruhe zuhause arbeiten zu können (siehe WennMaschinenMiteinanderReden).
Nun fangen die verd... Firmen auch noch auf dem Handy an und nerven an den unmöglichsten Orten. Zeit also auch für mich, wieder eine Stufe aufzurüsten.
Die Firma tellows, bei der die Community störende Anrufe in eine Datenbank eintragen und auf einer Nervskala von 0 bis 9 taxieren kann, bietet jetzt kostenpflichtig sowohl eine Android- und iOS-App als auch eine importierbare Liste für die Fritzbox an. Beide Lösungen sperren die Anrufe nicht, informieren aber immerhin den User, welcher Ärger am anderen Ende der Leitung droht. Beim Handy lässt sich diesen Anrufen ein stummer Klingelton zuweisen, so dass man gar nicht mehr mitbekommt, wenn Anrufe erfolgen.
Drahtloses Übertragen von Videobildern ist cool - wenn es denn funktioniert! Vor zwei Jahren hatte ich einige Lösungen vorgestellt, bei denen ein Computer ein Apple TV simuliert und als Empfänger für AirPlay-Signale dient (Fall 1).


Es ist keine Woche her, seit die Kolumne Machen Sie den Bücher-Check publiziert worden ist, da lese ich in der Süddeutschen Zeitung den Gastkommentar von Sandra Richter, Leiterin des Deutschen Literaturarchivs Marbach. Unter dem Titel Blättern und Wischen (Biblionetz:t24185) schreibt sie:
Textdeutungen auf Knopfdruck können Computer bislang nicht liefern. Vielleicht
ist die Interpretation, das Gespräch zwischen Autor, Text und Leser, ja eine
spezifisch menschliche Gabe? Dem Computer sind Sinn und Bedeutung
gleichgültig. Sinnerfüllte und historisch informierte Textdeutungen lassen sich
ebenso wenig maschinell erzeugen wie zwischenmenschliche Erfahrungen und
ausgewogene Urteile. Algorithmen für Einordungsvermögen, ästhetischen Sinn
und textsensible Deutung sind nicht in Aussicht. Als Lehrer, Vorbild oder
Meisterinterpret taugt der PC nicht.
Ersetzen wir nun in diesem Abschnitt den Begriff Computer durch den Begriff Buch, so sieht der Abschnitt folgendermassen aus:
Machen Sie den Bücher-Check!
21 April 2019
| Beat Döbeli Honegger
Die ewigen Schwarz-weiss-Diskussionen zur Digitalisierung in der Bildung sind sowas von ermüdend. Meine ewigen Aufrufe zu differenzierteren Auseinandersetzungen vermutlich auch:

 (Biblionetz:t24000)
(Biblionetz:t24000)

Der Schweizer Medienpädagoge Heinz Moser schrieb in seinem Buch «Der Computer vor der Schultür» im Jahr 1986: «Anpassung oder Widerstand, das ist heute eine überholte und verfehlte Frage. Weigern sich Lehrer, Eltern oder Schulbehörden, sich mit diesen Problemen auseinanderzusetzen, dann geben sie lediglich ihr Mitspracherecht sang- und klanglos preis. Denn die Computer sind schon da, mitten in unserer Gesellschaft nur manche haben dies noch nicht gemerkt.»
Heute, 33 Jahre später, dürften dies alle gemerkt haben. Die Digitalisierung hat längst alle Bereiche unseres Lebens durchdrungen und verändert, sowohl Berufs- und Privatleben als auch politische und gesellschaftliche Kontexte. Es ist deshalb wichtig und richtig, dass auch verstärkt über die Digitalisierung in allen Bereichen unseres Lebens kontrovers diskutiert wird. Gerade weil sich vieles ändert,
müssen wir uns als Gesellschaft streiten, in welche Richtung sich die Informationsgesellschaft bewegen soll welche Entwicklungen wir uns wünschen und welche wir lieber verhindern möchten.
Sorge bereitet mir hingegen, dass auch über dreissig Jahre nach Mosers Worten oft immer noch schwarz-weiss argumentiert wird: Wald oder Web? Buch oder Bildschirm? Tinte oder Tastatur? Diese scheinbaren Gegensätze beschreiben jedoch unsere Realität immer weniger. Schreiben von Hand und Computer schliessen sich längst nicht mehr aus, weil immer mehr Geräte das handschriftliche Notieren mit Stift ermöglichen. Bücher lassen sich nicht nur auf Papier, sondern auch auf Tablets und E-Reader lesen. Und eine Schulklasse kann sehr wohl am Vormittag den Wald besuchen und am Nachmittag den Fuchs, den sie im Wald nicht getroffen hat, im Web bewundern.
Bald vierzig Jahre nach dem Einzug der ersten Computer in Schweizer Schulen und Privathaushalte hat sich das Digitale ähnlich stark mit unserem Alltag verwoben wie etwa die Schrift. Ein Leben ohne ist zwar noch knapp vorstellbar, aber doch eher alltagsfern. Niemand würde bei der Schrift behaupten, sie sei an sich gut oder böse. Niemand würde vor zu viel Schrift warnen oder einen schriftfreien Tag pro Woche einfordern denn selbst beim Wandern in der Natur ist es nicht schlecht, den Wegweiser lesen zu können.
Genauso sollten wir beim Digitalen einsehen, dass es nicht um ein simples «Mehr!» oder «Weniger!» gehen kann. Wir müssen genauer hinschauen. «Jetzt sitzt er oder sie schon wieder vor dem Bildschirm!», kann vieles heissen. Liest er ein Buch? Schaut sie fern?
Macht er Hausaufgaben? Spielt sie ein Computerspiel? Kommuniziert er mit Kollegen?
Wenn uns jemand erzählt, im Silicon Valley würden immer mehr Eltern ihre Kinder in Waldorf-Schulen schicken, müssen wir uns fragen,
woran das liegt: Wollen die Computerfachleute ihre Kinder möglichst lange vor dem Digitalen bewahren oder können sich Gutverdienende schlicht eher Privatschulen mit besserer Betreuung leisten?
Auch die Geschichten von Apple-Gründer Steve Jobs und Microsoft-Gründer Bill Gates, die ihre Kinder angeblich vor digitalen Medien ferngehalten haben, klingen erst einmal überzeugend: «Die beiden wussten um die problematischen Aspekte dieser Geräte vielleicht sollten wir das mit unseren Kindern ähnlich handhaben!» Ruft man sich aber in Erinnerung, dass die zwei ihr Studium abgebrochen haben, wünscht man sich vielleicht doch andere Vorbilder für Sohn und Tochter.
Deshalb: Seien Sie kritisch! Einerseits: Digital ist nicht automatisch besser. Andererseits: Trifft die Kritik wirklich nur auf das Digitale zu? Machen Sie den Bücher-Check, wenn Ihnen wieder mal ein Argument gegen die Digitalisierung begegnet! Ersetzen Sie im Argument den Begriff «Computer » durch «Bücher» und fragen Sie sich: Ist das mit Büchern nicht ähnlich? Macht ständiges Lesen wirklich weniger einsam und dick als Computer und Internet? Geben Bücher nicht genauso nur eine medial vermittelte Wirklichkeit wieder, wie dies Computern und Internet vorgeworfen wird? Ich freue mich auf künftige Diskussionen mit mehr Farben als bloss Schwarz und Weiss!
Quelle: Bote der Urschweiz, 18.04.2019  (Biblionetz:t24000)
(Biblionetz:t24000)
Das Biblionetz ist unterdessen mehr als 20 Jahre alt. Es gibt darin gewisse Themen, die ich nicht mehr so aktiv beackere. Seit mehreren Jahren gibt es deshalb einen Automatismus, der auf Biblionetzseiten, die sich seit mehr als sechs Monaten inhaltlich nicht mehr geändert haben, eine entsprechende Warnmeldung platziert:
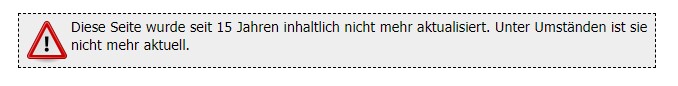
Warum mache ich das?
Bei gedruckten Texten ist die Sache vergleichsweise einfach: Es genügt die Angabe eines Publikationsdatums, damit Leserinnen und Leser wissen, zu welchem Zeitpunkt letztmals aktuelle Informationen in einen Text hätten aufgenommen werden konnten, denn schliesslich lassen sich gedruckte Texte nicht nachträglich aktualisiert werden.
Bei digital online verfügbaren Texten ist es komplizierter: Es ist jederzeit möglich, die Inhalte zu verändern. Das Erstpublikationsdatum einer online verfügbaren Ressource sagt somit nichts darüber aus, wann diese Ressource letztmals verändert worden ist - es ist somit nicht auf einen Blick ersichtlich, wie veraltet die Ressource sein könnte. Aus diesem Grund erachte ich es als sinnvoll, wenn meine Webseiten deutlich deklarieren, wann sie zum letzten Mal aktualisiert worden sind.
Für mich ist dies eine Dienstleistung für Besucherinnen & Besucher und ich bin eigentlich erstaunt, dass ich keine anderen Webseiten kenne, die dies auch so handhaben.
Ganz pragmatisch ersparen mir diese Hinweise auch zahlreiche Mails von Besucherinnen und Besuchern, die mich - erraten - auf veraltete Informationen hinweisen wollen.
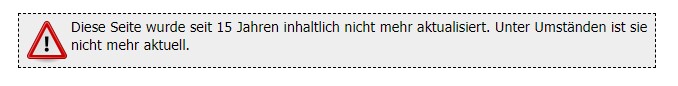
Kontakt
- Beat Döbeli Honegger
- Plattenstrasse 80
- CH-8032 Zürich
- E-mail: beat@doebe.li
About me
Social Media
This page was cached on 22 Dec 2025 - 04:19.
