Weblog von Beat Döbeli Honegger
Privates Weblog von Beat Döbeli Honegger
Categories
- 64 Annoyance
- 120 Biblionetz
- 7 Bildschirme
- 6 Bildungspolitik
- 6 CT
- 8 DPM
- 11 Digital Immigrants
- 3 Elektromobil
- 9 GMLS
- 64 Gadget
- 53 Geek
- 7 GeoLocation
- 14 HandheldInSchool
- 105 Informatik
- 25 Information-Architecture (IA)
- 11 Kid
- 78 Medienbericht
- 131 Medienbildung
- 6 Modelle
- 30 OLPC
- 49 PH Solothurn
- 35 PHSZ
- 4 RechtUndInformatik
- 154 Schul-ICT
- 20 Scratch
- 7 SecondLife
- 104 Software
- 52 Tablet-PC
- 144 Veranstaltung
- 15 Video
- 60 Visualisierung
- 123 Wiki
- 19 Wissenschaft
Archive
- 2May 2025
- 5Sep 2024
- 1Aug 2024
- 2Jul 2024
- 1Jan 2024
- 1Dec 2023
- 1Sep 2023
- 2Jul 2023
- 1Jun 2023
- 1Mar 2023
- 1Feb 2023
- 1Jan 2023
- 1Jul 2022
- 1Jan 2022
- 1Oct 2021
- 1Sep 2021
- 1Jun 2021
- 2Apr 2021
- 1Feb 2021
- 1Nov 2020
- 3Sep 2020
- 2Jun 2020
- 1May 2020
- 1Apr 2020
- 2Mar 2020
- 1Feb 2020
- 2Jan 2020
- 1Dec 2019
- 1Nov 2019
- 1Oct 2019
- 4Sep 2019
- 1Jul 2019
- 1Jun 2019
- 3Apr 2019
- 1Mar 2019
- 3Jan 2019
- 1Dec 2018
- 1Nov 2018
- 1Oct 2018
- 1Aug 2018
- 4Jun 2018
- 2Dec 2017
- 3Nov 2017
- 2Oct 2017
- 5Sep 2017
- 4Jul 2017
- 1Jun 2017
- 1Apr 2017
- 1Jan 2017
- 3Dec 2016
- 3Nov 2016
- 1Oct 2016
- 3Sep 2016
- 1Aug 2016
- 1Jun 2016
- 3May 2016
- 4Apr 2016
- 3Mar 2016
- 4Jan 2016
- 3Dec 2015
- 3Nov 2015
- 2Oct 2015
- 3Sep 2015
- 4Aug 2015
- 3Jul 2015
- 5Jun 2015
- 8May 2015
- 5Apr 2015
- 6Mar 2015
- 5Feb 2015
- 6Jan 2015
- 6Dec 2014
- 10Nov 2014
- 5Oct 2014
- 9Sep 2014
- 3Aug 2014
- 3Jul 2014
- 6Jun 2014
- 4May 2014
- 8Apr 2014
- 6Mar 2014
- 5Feb 2014
- 4Jan 2014
- 6Dec 2013
- 7Nov 2013
- 15Oct 2013
- 4Sep 2013
- 8Aug 2013
- 7Jul 2013
- 13Jun 2013
- 5May 2013
- 5Apr 2013
- 8Mar 2013
- 4Feb 2013
- 10Jan 2013
- 9Dec 2012
- 7Nov 2012
- 10Oct 2012
- 7Sep 2012
- 8Aug 2012
- 7Jul 2012
- 4Jun 2012
- 3May 2012
- 9Apr 2012
- 9Mar 2012
- 1Feb 2012
- 6Jan 2012
- 9Dec 2011
- 3Nov 2011
- 10Oct 2011
- 13Sep 2011
- 4Aug 2011
- 8Jul 2011
- 7Jun 2011
- 8May 2011
- 7Apr 2011
- 4Mar 2011
- 3Feb 2011
- 7Jan 2011
- 7Dec 2010
- 10Nov 2010
- 11Oct 2010
- 9Sep 2010
- 6Aug 2010
- 6Jul 2010
- 2Jun 2010
- 6May 2010
- 8Apr 2010
- 7Mar 2010
- 8Feb 2010
- 10Jan 2010
- 6Dec 2009
- 11Nov 2009
- 8Oct 2009
- 14Sep 2009
- 7Aug 2009
- 11Jul 2009
- 5Jun 2009
- 14May 2009
- 21Apr 2009
- 14Mar 2009
- 20Feb 2009
- 14Jan 2009
- 9Dec 2008
- 14Nov 2008
- 9Oct 2008
- 11Sep 2008
- 15Aug 2008
- 9Jul 2008
- 8Jun 2008
- 14May 2008
- 15Apr 2008
- 14Mar 2008
- 19Feb 2008
- 18Jan 2008
- 17Dec 2007
- 16Nov 2007
- 25Oct 2007
- 10Sep 2007
- 27Aug 2007
- 16Jul 2007
- 27Jun 2007
- 31May 2007
- 28Apr 2007
- 12Mar 2007
- 34Feb 2007
- 31Jan 2007
- 29Dec 2006
- 33Nov 2006
- 20Oct 2006
- 35Sep 2006
- 42Aug 2006
- 35Jul 2006
- 31Jun 2006
- 29May 2006
- 23Apr 2006
- 20Mar 2006
- 23Feb 2006
- 43Jan 2006
- 26Dec 2005
- 31Nov 2005
- 31Oct 2005
- 14Sep 2005
- 31Aug 2005
- 24Jul 2005
- 1Jul 2004
You are here: Weblog von Beat Döbeli Honegger
Neue Blog-Engine
Alles Neu macht der Mai
Seit heute (17.05.2025) läuft mein Weblog nach ca. 20 Jahren mit einem neuen Unterbau. Ich verwende neue das Blog-Plugin von Foswiki. Für Leser:innen sollte sich im Idealfall wenig ändern: Alle URLs bleiben identisch, neu ist nur die rechte Spalte, wo sich Postings nach Datum oder Kategorien abrufen lassen.
Fehlermeldungen gerne an beat@doebe.li
Damit verbunden ist auch meine Absicht, in Zukunft wieder öfters zu bloggen.
Diesen Monat ist mir eine weitere Frage im Zusammenhang mit generativen Machine-Learning-Systemen (GMLS) bewusst geworden, die mich nun beschäftigt: Was denken wir über die GMLS-Nutzung anderer Menschen? (Biblionetz:f167)
Im Juni 2024 hat die Schwyzer Ständerätin den Bundesrat in einer Interpellation (Biblionetz:t32003) gefragt:
[...]
KI-Anwendungen der generativen Künstlichen Intelligenz bedienen sich journalistischer Inhalte und geben diese in gewünschter Form wieder (z.B. in KI-Chatbots). [...]
Ist sich der Bundesrat bewusst, dass Bezahlschranken teilweise nicht ausreichen, um Inhalte und damit das Geschäftsmodell der Medienschaffenden zu schützen, da diese durch künstliche Intelligenz umgangen werden?
Quelle: Interpellation 24.3616 "Medien und künstliche Intelligenz, Hervorhebung von mir
KI-Anwendungen der generativen Künstlichen Intelligenz bedienen sich journalistischer Inhalte und geben diese in gewünschter Form wieder (z.B. in KI-Chatbots). [...]
Ist sich der Bundesrat bewusst, dass Bezahlschranken teilweise nicht ausreichen, um Inhalte und damit das Geschäftsmodell der Medienschaffenden zu schützen, da diese durch künstliche Intelligenz umgangen werden?
Quelle: Interpellation 24.3616 "Medien und künstliche Intelligenz, Hervorhebung von mir
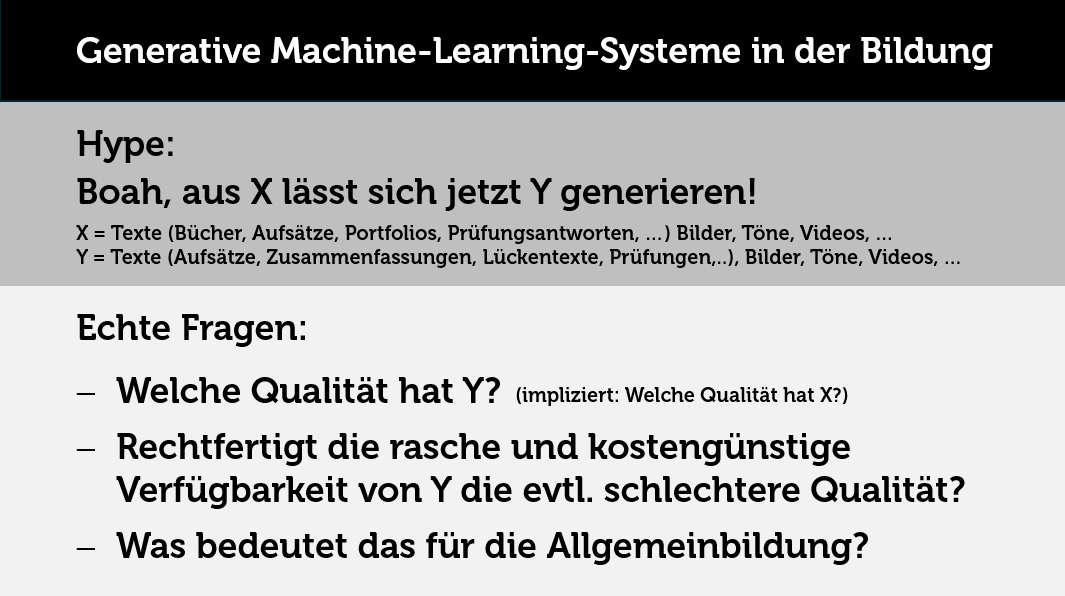
Derzeit werden allerorten empirische Untersuchungen durchgeführt, wie gut generative Machine-Learning-Systeme (Biblionetz:w02833) sich zum Lernen eignen. Zur Einordnung: GMLS in der Bildung (Biblionetz:w03434), Lernen MIT GMLS.
Da viele dieser Untersuchungen ähnlich aufgebaut sind, habe ich mir die Grundstruktur solcher Evaluationen aufgezeichnet :
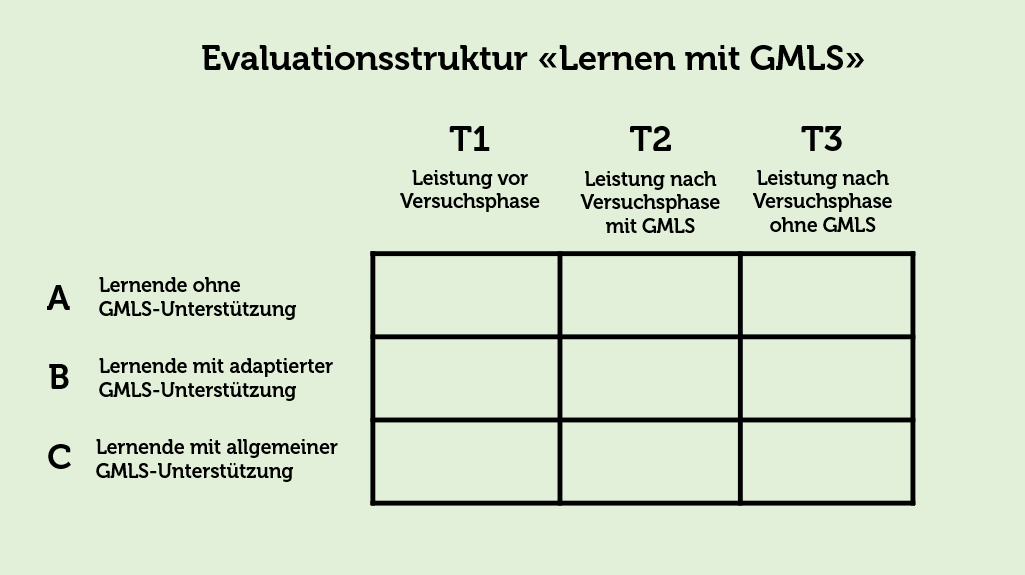
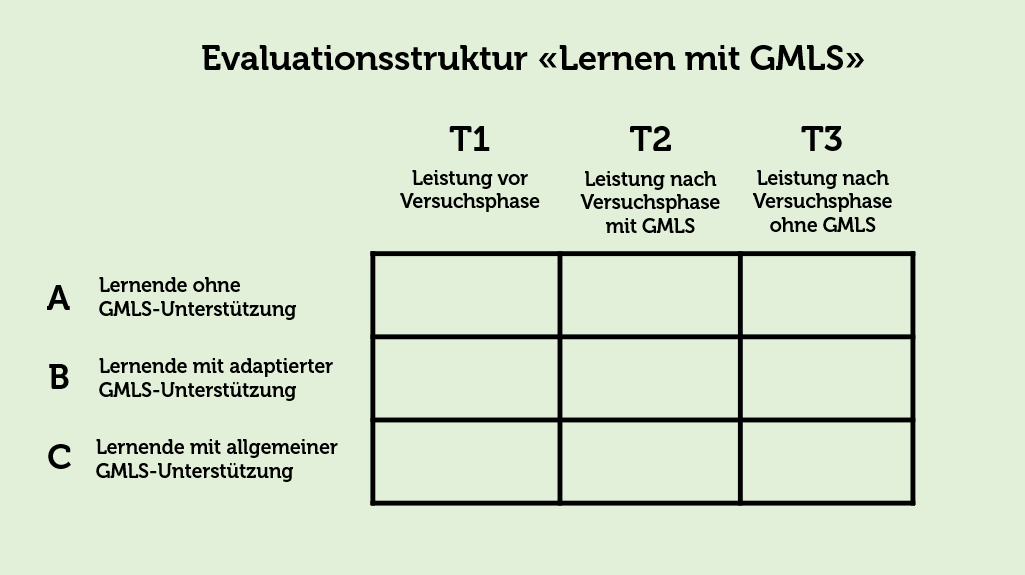
Kontakt
- Beat Döbeli Honegger
- Plattenstrasse 80
- CH-8032 Zürich
- E-mail: beat@doebe.li
