Schul-ICT
Schul-ICT Archive
- 1Nov 2020
- 1Sep 2020
- 1Jun 2017
- 1May 2016
- 1Nov 2015
- 1Oct 2015
- 1Sep 2015
- 1Jan 2015
- 2Oct 2014
- 1Sep 2014
- 1Aug 2014
- 4Jun 2014
- 2Mar 2014
- 1Feb 2014
- 1Dec 2013
- 1Nov 2013
- 2Oct 2013
- 5Aug 2013
- 2Jun 2013
- 1Feb 2013
- 2Jan 2013
- 2Dec 2012
- 1Oct 2012
- 1Sep 2012
- 1Aug 2012
- 2Jul 2012
- 1Jun 2012
- 1May 2012
- 1Apr 2012
- 2Mar 2012
- 1Feb 2012
- 2Jan 2012
- 3Dec 2011
- 2Nov 2011
- 4Sep 2011
- 1Aug 2011
- 2Jul 2011
- 3Jun 2011
- 1Mar 2011
- 2Jan 2011
- 2Oct 2010
- 1Sep 2010
- 1Jul 2010
- 2Apr 2010
- 2Mar 2010
- 5Feb 2010
- 2Jan 2010
- 1Nov 2009
- 1Sep 2009
- 1Jul 2009
- 2Jun 2009
- 2May 2009
- 3Apr 2009
- 1Mar 2009
- 1Jan 2009
- 3Mar 2008
- 2Feb 2008
- 1Jan 2008
- 1Dec 2007
- 1Nov 2007
- 1Oct 2007
- 1Sep 2007
- 2Aug 2007
- 6Jun 2007
- 4May 2007
- 1Apr 2007
- 1Mar 2007
- 8Feb 2007
- 3Jan 2007
- 5Dec 2006
- 3Nov 2006
- 1Oct 2006
- 2Sep 2006
- 3Aug 2006
- 4Jul 2006
- 6Mar 2006
- 1Dec 2005
- 1Jul 2005
Schul-ICT
 Vor etwa drei Wochen ist die Ausgabe 03/2007 der PHZ-Hauszeitschrift PHZ inforum auf Papier erschienen (die digitale Ausgabe sollte laut Auskunft des Redaktors bald hier als PDF abrufbar sein).
Das Schwerpunktthema Wikipädagogik oder Pädablogik (Biblionetz:b03262) wird dabei von verschiedenen Mitarbeitenden der PHZ und von externen Autoren beleuchtet.
Von mir sind zwei Artikel im Heft zu finden. Einerseits ein Übersichtsartikel zu Web 2.0 (Biblionetz:t07900), der für ICT-Fachleute wenig Neues enthält. Daneben der kleinere Artikel Offenheit aushalten lernen Warum auch die schulische ICT-Infrastruktur offen für den Wandel sein muss (Biblionetz:t08000), der mir wesentlich mehr am Herzen liegt. Mit der Professionalisierung des ICT-Supports an Schulen und Hochschulen geht auch eine immer stärkere Reglementierung und Einschränkung von Möglichkeiten einher. Dabei wird oft übersehen, dass es nicht eine Bank zu schützen gilt, sondern dass das Lernen gefördert werden soll.
Vor etwa drei Wochen ist die Ausgabe 03/2007 der PHZ-Hauszeitschrift PHZ inforum auf Papier erschienen (die digitale Ausgabe sollte laut Auskunft des Redaktors bald hier als PDF abrufbar sein).
Das Schwerpunktthema Wikipädagogik oder Pädablogik (Biblionetz:b03262) wird dabei von verschiedenen Mitarbeitenden der PHZ und von externen Autoren beleuchtet.
Von mir sind zwei Artikel im Heft zu finden. Einerseits ein Übersichtsartikel zu Web 2.0 (Biblionetz:t07900), der für ICT-Fachleute wenig Neues enthält. Daneben der kleinere Artikel Offenheit aushalten lernen Warum auch die schulische ICT-Infrastruktur offen für den Wandel sein muss (Biblionetz:t08000), der mir wesentlich mehr am Herzen liegt. Mit der Professionalisierung des ICT-Supports an Schulen und Hochschulen geht auch eine immer stärkere Reglementierung und Einschränkung von Möglichkeiten einher. Dabei wird oft übersehen, dass es nicht eine Bank zu schützen gilt, sondern dass das Lernen gefördert werden soll.
Lernen hat mit Unbekanntem zu tun. Es erfordert Offenheit für Neues und
Vertrauen. Wer nur Bekanntes zulässt, lernt nicht. Diese alte Weisheit gilt in
der Informationsgesellschaft noch stärker als früher. Neben den Lehrerinnen
und Lehrern muss aber auch die virtuelle Schulumgebung offen sein, um
Neues und Unbekanntes zuzulassen.
 "Da kommt ja der Begriff Wiki gar nicht vor!" war der erstaunte Kommentar eines Kollegen, der vor einem halben Jahr einen Entwurf meines Beitrags zum von Hartmut Mitzlaff herausgegebenen Buch Computer (ICT), Grundschule, Kindergarten und Neue Lernkultur (Biblionetz:b02955) gelesen hat.
Ja, auch wenn man es diesem Blog nicht anmerken würde, ich versuche mich dem ausschliesslichen Image als [[][Geek]] (Biblionetz:a00629) und Wiki-Wanderprediger zu entziehen.
Im Beitrag Überlegungen zum ICT-Management an Primarschulen (Biblionetz:t07383) versuche ich die Grundüberlegungen der Publikation Informations- und Kommunikationstechnologien (ICT) in der Primarschule, Eine Planungshilfe für die Beschaffung und den Betrieb (Biblionetz:b01956) aus dem Jahr 2004 für den Kanton Basel Landschaft zusammenzufassen und mit den Erfahrungen der Beratungstätigkeit im Kanton Solothurn zu verbinden. Eine wesentliche Erkenntnis dieser Praxistätigkeit ist dabei:
"Da kommt ja der Begriff Wiki gar nicht vor!" war der erstaunte Kommentar eines Kollegen, der vor einem halben Jahr einen Entwurf meines Beitrags zum von Hartmut Mitzlaff herausgegebenen Buch Computer (ICT), Grundschule, Kindergarten und Neue Lernkultur (Biblionetz:b02955) gelesen hat.
Ja, auch wenn man es diesem Blog nicht anmerken würde, ich versuche mich dem ausschliesslichen Image als [[][Geek]] (Biblionetz:a00629) und Wiki-Wanderprediger zu entziehen.
Im Beitrag Überlegungen zum ICT-Management an Primarschulen (Biblionetz:t07383) versuche ich die Grundüberlegungen der Publikation Informations- und Kommunikationstechnologien (ICT) in der Primarschule, Eine Planungshilfe für die Beschaffung und den Betrieb (Biblionetz:b01956) aus dem Jahr 2004 für den Kanton Basel Landschaft zusammenzufassen und mit den Erfahrungen der Beratungstätigkeit im Kanton Solothurn zu verbinden. Eine wesentliche Erkenntnis dieser Praxistätigkeit ist dabei:
Regionale ICT-Planung als wünschenswerte, aber schwierige Aufgabe
Angesichts der eingangs erwähnten Herausforderungen für einzelne Schulen und der Sinnhaftigkeit der Standardisierung ist eine regionale ICT-Planung wünschenswert. Solange eine solche Planung keinerlei Verbindlichkeit besitzt und die Autonomie der Akteure nicht beschränkt, erwächst ihr selten Widerstand. Versucht aber eine politische Instanz, gewisse Vorgaben für verbindlich zu erklären, um auch die entsprechenden Synergieeffekte zu nutzen, so ist mit Opposition zu rechnen. Dieser Widerstand gegen verbindliche Vorgaben der höheren Instanzen ist auf verschiedenen politischen Ebenen zu beobachten und ist nicht auf Informatikmittel an Schulen beschränkt. Abbildung 3 zeigt am Beispiel der Schweizer Primarschulen, dass sich Koordinations- und Autonomiewunsch auf verschiedenen Ebenen gegenüber stehen. 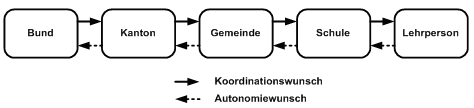
Über die anderen Kapitel des Buches kann ich leider noch nichts sagen, da das Belegexemplar erst in den nächsten Tagen bei mir eintreffen wird. Das Inhaltsverzeichnis macht aber Appetit auf die Lektüre!
Angesichts der eingangs erwähnten Herausforderungen für einzelne Schulen und der Sinnhaftigkeit der Standardisierung ist eine regionale ICT-Planung wünschenswert. Solange eine solche Planung keinerlei Verbindlichkeit besitzt und die Autonomie der Akteure nicht beschränkt, erwächst ihr selten Widerstand. Versucht aber eine politische Instanz, gewisse Vorgaben für verbindlich zu erklären, um auch die entsprechenden Synergieeffekte zu nutzen, so ist mit Opposition zu rechnen. Dieser Widerstand gegen verbindliche Vorgaben der höheren Instanzen ist auf verschiedenen politischen Ebenen zu beobachten und ist nicht auf Informatikmittel an Schulen beschränkt. Abbildung 3 zeigt am Beispiel der Schweizer Primarschulen, dass sich Koordinations- und Autonomiewunsch auf verschiedenen Ebenen gegenüber stehen.
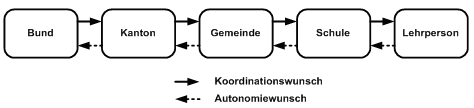
 Zu den Veranstaltungen, die ich verpasst habe, gehört auch das Abschlussevent der Schweizerischen Schul-ICT-Initiative PPP-SiN (Biblionetz:w01006) vom 7. September 2007.
Im Beisein von Bundesrätin Doris Leuthard und EDK-Präsidentin Isabelle Chassot wurde der Abschluss des fünfjährigen Public-Private-Partnership-Förderprogramms gefeiert. Gleichzeitig wurde auch die Abschlusspublikation ICT und Bildung: Hype oder Umbruch (Biblionetz:b03201) präsentiert. Abgesehen vom Kapitel von Dominik Petko und Jean-Luc Barras ist sie leider nicht online verfügbar (das alte Lied: Von neuen Medien reden und alte Medien produzieren.)
Als ehemaliges Mitglied der Expertengruppe PPP-SiN habe ich aber netterweise ein Papierexemplar zugeschickt erhalten, so dass ich es immerhin bereits durchblättern konnte. Hängengeblieben bin ich an den Ergebnissen der Evaluationsstude von Barras und Petko (Biblionetz:t07870), die einiges an interessantem Zahlenmaterial liefert.
Die Studie zeigt z.B. wie stark die Einschränkungen in der Computernutzung zugenommen haben:
Zu den Veranstaltungen, die ich verpasst habe, gehört auch das Abschlussevent der Schweizerischen Schul-ICT-Initiative PPP-SiN (Biblionetz:w01006) vom 7. September 2007.
Im Beisein von Bundesrätin Doris Leuthard und EDK-Präsidentin Isabelle Chassot wurde der Abschluss des fünfjährigen Public-Private-Partnership-Förderprogramms gefeiert. Gleichzeitig wurde auch die Abschlusspublikation ICT und Bildung: Hype oder Umbruch (Biblionetz:b03201) präsentiert. Abgesehen vom Kapitel von Dominik Petko und Jean-Luc Barras ist sie leider nicht online verfügbar (das alte Lied: Von neuen Medien reden und alte Medien produzieren.)
Als ehemaliges Mitglied der Expertengruppe PPP-SiN habe ich aber netterweise ein Papierexemplar zugeschickt erhalten, so dass ich es immerhin bereits durchblättern konnte. Hängengeblieben bin ich an den Ergebnissen der Evaluationsstude von Barras und Petko (Biblionetz:t07870), die einiges an interessantem Zahlenmaterial liefert.
Die Studie zeigt z.B. wie stark die Einschränkungen in der Computernutzung zugenommen haben:
- "In 35,7% der Schulen dürfen Lehrpersonen neue Programme auf den Computern der Schule installieren."
- "selbstständig Programme auf Schulcomputern installieren dürfen Lernende nur an 2,2% der Schulen."
Im Mittel machen 48% der Schweizer Schulen Gebrauch von einer solchen Lernplattform. Die Nutzungsquote ist auf Volksschulstufe in der Romandie deutlich höher als in der Deutschschweiz. Unter den Schulen, die eine Plattform verwenden, nutzen 91,7% educanet2, die Lernplattform des schweizerischen Bildungsservers. 4,8% verwenden Moodle, 3,2% BSCW, 1,6% Ilias, 0,7% Claroline und 8,3% machen von anderen Plattformen Gebrauch (Mehrfachnennungen möglich). Virtuelle Arbeitsräume ausserhalb von Lernplattformen werden von 19,8% der Schulen genutzt. Von diesen Schulen verwenden 30% einen Online-Kalender, 28,5% ein Wiki, 26,1% ein Online-Publikationssystem und 25,5% Foren. Auch bei den virtuellen Arbeitsräumen ist die Nutzungsquote in der Romandie höher als in der Deutschschweiz. In der Deutschschweiz findet im Verhältnis das Wiki etwas stärkere Verbreitung.
,
Wie die Netzzeitung berichtet, wurde in Australien ein für 51 Millionen Euro von der Regierung entwickelter Porno-Webfilter (Biblionetz:w00872) innert 30 Minuten von einem 16jährigen Schüler geknackt. Für das Knacken der überarbeiteten Version benötigte er dann immerhin 40 Minuten.
Tja, dass technische Internetfilter zu Jugendschutzzwekcen nicht optimal sind, wurde bereits 1999 festgestellt (Biblionetz:w00935) und darum empfehlen wir auch im Educaguide Infrastruktur Ergreifen Sie keine technischen Massnahmen gegen unerwünschtes Verhalten der Lernenden
Netzpolitik.org bemerkt bissig:
Vielleicht hätte man die Gelder auch zur Förderung von Medienkompetenz ausgeben können, anstatt der Illusion von Zensurinfrastrukturen zu verfallen.
P.S: Leider fehlt dem Artikel jeglicher Quellenhinweis.
Im heutigen Tages-Anzeiger vom 13.8.2007 ist auf der Frontseite des Wirtschaftsbundes ein Artikel zum Risiko von Wireless LAN (Biblionetz:w01601) unter der reisserischen Schlagzeile Drahtloses Internet strahlt stärker als Handy

Der Artikel bezieht sich dabei auf den Bericht des Bundesamtes für Gesundheit Risikopotenzial von drahtlosen Netzwerken (Biblionetz:b03090) in Erfüllung des Postulates 04.3594 Allemann vom 8. Oktober 2004.
Dieser Bericht wiederum zitiert einen Artikel in der Zeitschrift PRAXIS von Oertle et al. Elektromagnetische Felder im Akutspital (Biblionetz:t07844). In diesem Artikel wird die Strahlenbelastung im Schwesternzimmer direkt neben dem mit Datentransfer belasteten Access-Point und im Patientenzimmer nach Verursachern gemessen und dargestellt. Es ist nicht überraschend, dass die Strahlenbelastung im Schwesterzimmer direkt neben dem Access-Point durch WLAN am grössten ist. Da aber, (was auch im Artikel des Tages-Anzeigers betont wird), die Strahlenbelastung quadratisch mit dem Abstand zum Sender abnimmt, lässt sich aus diesem PRAXIS-Artikel nicht folgern, dass WLAN allgemein stärker strahlt als ein Handy. Hätte man das Handy neben das Messinstrument gelegt, wäre das Handy die stärkste Strahlenquelle gewesen.
Ich bin durchaus für einen kritischen Umgang mit technologischen Gefahren und unterstütze auch die im Artikel des Tages-Anzeigers gemachte Empfehlung, WLAN-Access-Points nicht direkt neben Arbeitsplätzen oder Aufenthaltsorten von Menschen zu platzieren (Mit einer Entfernung vom 2m ist aber die Strahlenbelastung bereits massiv geringer.)
Irreführend ist aber die reisserische Schlagzeile, die nun wieder für viele Diskussionen in Schul-ICT-Projekten führen wird. Dass die Kinder gleichzeitig ihr Mobiltelefon in der Hosentasche haben, wird dabei oft nicht bedacht.
P.S.: Die Legende der Grafik rechts unten im Artikel des Tages-Anzeigers ist falsch: Patientenzimmer und Schwesternzimmer wurden vertauscht.
,

Kontakt
- Beat Döbeli Honegger
- Plattenstrasse 80
- CH-8032 Zürich
- E-mail: beat@doebe.li
About me
Social Media
This page was cached on 21 Nov 2025 - 05:27.
