Schul-ICT
Schul-ICT Archive
- 1Nov 2020
- 1Sep 2020
- 1Jun 2017
- 1May 2016
- 1Nov 2015
- 1Oct 2015
- 1Sep 2015
- 1Jan 2015
- 2Oct 2014
- 1Sep 2014
- 1Aug 2014
- 4Jun 2014
- 2Mar 2014
- 1Feb 2014
- 1Dec 2013
- 1Nov 2013
- 2Oct 2013
- 5Aug 2013
- 2Jun 2013
- 1Feb 2013
- 2Jan 2013
- 2Dec 2012
- 1Oct 2012
- 1Sep 2012
- 1Aug 2012
- 2Jul 2012
- 1Jun 2012
- 1May 2012
- 1Apr 2012
- 2Mar 2012
- 1Feb 2012
- 2Jan 2012
- 3Dec 2011
- 2Nov 2011
- 4Sep 2011
- 1Aug 2011
- 2Jul 2011
- 3Jun 2011
- 1Mar 2011
- 2Jan 2011
- 2Oct 2010
- 1Sep 2010
- 1Jul 2010
- 2Apr 2010
- 2Mar 2010
- 5Feb 2010
- 2Jan 2010
- 1Nov 2009
- 1Sep 2009
- 1Jul 2009
- 2Jun 2009
- 2May 2009
- 3Apr 2009
- 1Mar 2009
- 1Jan 2009
- 3Mar 2008
- 2Feb 2008
- 1Jan 2008
- 1Dec 2007
- 1Nov 2007
- 1Oct 2007
- 1Sep 2007
- 2Aug 2007
- 6Jun 2007
- 4May 2007
- 1Apr 2007
- 1Mar 2007
- 8Feb 2007
- 3Jan 2007
- 5Dec 2006
- 3Nov 2006
- 1Oct 2006
- 2Sep 2006
- 3Aug 2006
- 4Jul 2006
- 6Mar 2006
- 1Dec 2005
- 1Jul 2005
Schul-ICT
Während an den morgigen Berner Telematiktagen das Learning Management System Blackboard (Biblionetz:w01598) als state of the art learning management system präsentiert werden wird, urteilt die Edu-Blogosphäre derzeit deutlich negativer. Der Grund ist ein laufender Patentstreit:
Die Firma Blackboard hat im Januar 1996 das US-Patent Patent 6,988,138  über "Internet-based education support system and methods" zugesprochen erhalten, das Verfahren zur webbasierten Ankündigung, Studierendenzuteilung, Informationanzeige und Noteneinsicht von Lehrveranstaltungen beschreibt. Bereits ein halbes Jahr später hat die Firma Blackboard Klage
über "Internet-based education support system and methods" zugesprochen erhalten, das Verfahren zur webbasierten Ankündigung, Studierendenzuteilung, Informationanzeige und Noteneinsicht von Lehrveranstaltungen beschreibt. Bereits ein halbes Jahr später hat die Firma Blackboard Klage  gegen die Firma Desire2Learn wegen Verletzung eben dieses Patents erhoben.
Darauf hin ging ein erster Sturm der Entrüstung los, weil viele das Patent von Blackboard als Trivialpatent bezeichneten. Die Beschreibung sei so allgemein gehalten, dass sich mit diesem Patent prakisch sämtliche derzeitigen Learning Management Systeme der Patentverletzung schuldig machen würden. Davon betroffen wären nicht nur kommerzielle Learning Management Systeme, sondern auch Open-Source-Produkte wie Moodle, Ilias oder Sakai.
Aus diesem Grund wurde in der Folge versucht, die Gültigkeit des Patents anzufechten, indem gezeigt werden soll, dass Blackboard nicht die ersten waren, welche die in der Patentschrift verwendeten Verfahren angewendet haben. Entsprechende Dokumentationen sind in der englischsprachigen Wikipedia und auf der Website von Moodle zu finden. Am 25.Januar 2007 wurde die Aufforderung ans US-Patentamt gutgeheissen, die Gültigkeit des Blackboard-Patents aufgrund der neuen Beweislage ("prior art") neu zu prüfen. Das Ergebnis dieser Gültigkeitsprüfung steht noch aus.
gegen die Firma Desire2Learn wegen Verletzung eben dieses Patents erhoben.
Darauf hin ging ein erster Sturm der Entrüstung los, weil viele das Patent von Blackboard als Trivialpatent bezeichneten. Die Beschreibung sei so allgemein gehalten, dass sich mit diesem Patent prakisch sämtliche derzeitigen Learning Management Systeme der Patentverletzung schuldig machen würden. Davon betroffen wären nicht nur kommerzielle Learning Management Systeme, sondern auch Open-Source-Produkte wie Moodle, Ilias oder Sakai.
Aus diesem Grund wurde in der Folge versucht, die Gültigkeit des Patents anzufechten, indem gezeigt werden soll, dass Blackboard nicht die ersten waren, welche die in der Patentschrift verwendeten Verfahren angewendet haben. Entsprechende Dokumentationen sind in der englischsprachigen Wikipedia und auf der Website von Moodle zu finden. Am 25.Januar 2007 wurde die Aufforderung ans US-Patentamt gutgeheissen, die Gültigkeit des Blackboard-Patents aufgrund der neuen Beweislage ("prior art") neu zu prüfen. Das Ergebnis dieser Gültigkeitsprüfung steht noch aus.

Ausgelöst durch diesen Patentstreit enstanden auch mehrere Protestbewegung, einerseits konkret gegen die Firma Blackboard unter http://www.boycottblackboard.org/ und andererseits generell gegen Patente im Bildungswesen.
Im Februar 2007 versuchte die Firma Blackboard die Wogen zu glätten, indem sie versicherte, ihre Patente nicht gegen Open Source LMS einzusetzen:
 über "Internet-based education support system and methods" zugesprochen erhalten, das Verfahren zur webbasierten Ankündigung, Studierendenzuteilung, Informationanzeige und Noteneinsicht von Lehrveranstaltungen beschreibt. Bereits ein halbes Jahr später hat die Firma Blackboard Klage
über "Internet-based education support system and methods" zugesprochen erhalten, das Verfahren zur webbasierten Ankündigung, Studierendenzuteilung, Informationanzeige und Noteneinsicht von Lehrveranstaltungen beschreibt. Bereits ein halbes Jahr später hat die Firma Blackboard Klage  gegen die Firma Desire2Learn wegen Verletzung eben dieses Patents erhoben.
Darauf hin ging ein erster Sturm der Entrüstung los, weil viele das Patent von Blackboard als Trivialpatent bezeichneten. Die Beschreibung sei so allgemein gehalten, dass sich mit diesem Patent prakisch sämtliche derzeitigen Learning Management Systeme der Patentverletzung schuldig machen würden. Davon betroffen wären nicht nur kommerzielle Learning Management Systeme, sondern auch Open-Source-Produkte wie Moodle, Ilias oder Sakai.
Aus diesem Grund wurde in der Folge versucht, die Gültigkeit des Patents anzufechten, indem gezeigt werden soll, dass Blackboard nicht die ersten waren, welche die in der Patentschrift verwendeten Verfahren angewendet haben. Entsprechende Dokumentationen sind in der englischsprachigen Wikipedia und auf der Website von Moodle zu finden. Am 25.Januar 2007 wurde die Aufforderung ans US-Patentamt gutgeheissen, die Gültigkeit des Blackboard-Patents aufgrund der neuen Beweislage ("prior art") neu zu prüfen. Das Ergebnis dieser Gültigkeitsprüfung steht noch aus.
gegen die Firma Desire2Learn wegen Verletzung eben dieses Patents erhoben.
Darauf hin ging ein erster Sturm der Entrüstung los, weil viele das Patent von Blackboard als Trivialpatent bezeichneten. Die Beschreibung sei so allgemein gehalten, dass sich mit diesem Patent prakisch sämtliche derzeitigen Learning Management Systeme der Patentverletzung schuldig machen würden. Davon betroffen wären nicht nur kommerzielle Learning Management Systeme, sondern auch Open-Source-Produkte wie Moodle, Ilias oder Sakai.
Aus diesem Grund wurde in der Folge versucht, die Gültigkeit des Patents anzufechten, indem gezeigt werden soll, dass Blackboard nicht die ersten waren, welche die in der Patentschrift verwendeten Verfahren angewendet haben. Entsprechende Dokumentationen sind in der englischsprachigen Wikipedia und auf der Website von Moodle zu finden. Am 25.Januar 2007 wurde die Aufforderung ans US-Patentamt gutgeheissen, die Gültigkeit des Blackboard-Patents aufgrund der neuen Beweislage ("prior art") neu zu prüfen. Das Ergebnis dieser Gültigkeitsprüfung steht noch aus.

Blackboard hereby commits not to assert any of the U.S. patents listed below, as well as all counterparts of these patents issued in other countries, against the development, use or distribution of Open Source Software or Home-Grown Systems to the extent that such Open Source Software and Home-Grown Systems are not Bundled with proprietary software.
Den Rechtsstreit mit der Firma Desire2Learn hingegen wurde aufrecht erhalten. Am 22. Februar 2008 hat nun ein texanisches Gericht entschieden, dass die Firma Desire2Learn tatsächlich das Patent der Firma Blackboard verletze, was den jüngsten Entrüstungssturm ausgelöst hat (z.B. bei slashdot).
Der endgültige Ausgang dieses Patentstreits ist noch nicht absehbar, da das Ergebnis der Gültigkeitsprüfung noch länger auf sich warten lassen dürfte.
Why do I blog this: Die ganze Geschichte ist aus zwei Gründen interessant: - Einerseits wird spannend zu beobachten sein, wie dieser Rechtsstreit die LMS-Szene beeinflusst, ob z.B. dadurch Open-Source-LMS Aufwind erhalten.
- Andererseits zeigt dieser Patentstreit deutlich, welche Folgen die Patentierbarkeit von Software haben kann. Dies könnte die Diskussion um Softwarepatente in Europa beeinflussen (siehe auch http://www.nosoftwarepatents.com).

- Durch die Nutzung von OLPCs in der Schweiz bekunden, dass die Stossrichtung OLPC förderungswürdig ist
- Durch die Nutzung von OLPCs in einem der reichsten Länder der Welt zeigen, dass OLPC kein Billig-PC (ausschliesslich) für Entwicklungsländer ist.
- Durch Adaptation an den deutschsprachigen (und französischsprachigen und italienischsprachigen) Raum die Verbreitung von OLPCs in diesen Sprachgebieten fördern
- Die Programmierumgebung Squeak im deutschsprachigen Raum fördern durch entsprechende Beispiele und Unterrichtsideen, die an Schweizer PHs entwickelt und in Schweizer Schulen erprobt wurden
- Die Bedeutung grundlegender Konzepte im Gegensatz zu Produktwissen betonen durch die Verwendung nicht marktgängiger Hard- und Software
- Der Schweizer Bildungslandschaft die Möglichkeiten persönlicher digitaler Lernwerkzeuge vor Augen führen
,
Entweder wars eine fiebrige Halluzination als letzter Auswuchs meiner bisher schlimmsten Grippe meines Lebens, oder ich habe mir vergangene Nacht im Internet einen OLPC (Biblionetz:w02041) ersteigert....

Mal sehen was passiert, wenn ich wieder gesund bin...
,

Als Microsoft im Sommer 2006 die Spezifikation des Ultra Mobile PC veröffentlichte und erste Geräte vorgestellt wurden, habe ich mich gefreut und mich auf den schulischen Einsatz von UMPCs gefreut. Angesichts der Preise ist meine Euphorie jedoch rasch wieder verflogen: Die bisher vorgestellten Geräte waren fast so teuer wie ausgewachsene Notebooks und stellten sich als absoluter Nischenmarkt heraus, dem auch die für schulische Zwecke notwendige Modellstabilität fehlen würde.
Der bisherige Erfolg Rummel um den OLPC, den vom MIT entwickelten Notebook für Entwicklungsländer, hat nun zur Folge, dass Bewegung in die Kleinstcomputerszene kommt. Der Computerhersteller ASUS hat vor kurzem den Asus Eee PC vorgestellt:
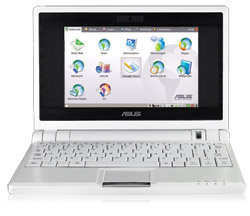
Es handelt sich um ein 920 Gramm leichtes Subnotebook in A5-Grösse. Statt einer stromfressenden und erschütterungssensitiven Festplatte wird ein 4 GByte grosser Solid State Speicher verwendet, von dem allerdings nur
1.7 GByte für Userdaten zur Verfügung stehen. Der Rest wird von einem Linux-OS und vorinstallierten Programmen besetzt: OpenOffice, Thunderbird, Skype, Bilderverwaltung, Ebook-Reader, Webbrowser, Messaging und mehr ist standardmässig verfügbar. Dank LAN, WLAN, USB, VGA, Mikrofon- und Lautsprecher sowie einer eingebauten Kamera (!) lässt sich das Gerät erstaunlich vielseitig verwenden. Tastatur und insbesondere der Bildschirm (800 x 480) sind recht klein geraten, was aber für gewisse Schulstufen kein Problem darstellen sollte.
Während der Asus Eee PC in Deutschland ab Dezember 2007 für 299 Euro erhältlich sein wird, ist laut infoweek die Markteinführung in der Schweiz erst im 1. Quartal 2008 geplant.
Asus plant für 2008 den Verkauf von zwei bis fünf Millionen Geräten. Dies könnte den Einsatz in der Schule begünstigen, da die Verbreitung zur Entwicklung von schulspezifischen Software-Images führen könnte. Mit einem Preis von unter CHF 500 rücken schulische One-to-One-Computing Projekte (Biblionetz:w00753) in realistische Nähe.
(Ein erster Testbericht findet sich in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift c't 24/2007, jkontheruns erste Eindrücke, jkontherun zeigt das Gerät seinem zehnjährigen Sohn).
Update 29.01.2008: Das Gerät ist bei digitec für CHF 499.- im Angebot, allerdings mit deutschem (nicht schweizer-deutschem) Tastaturlayout.
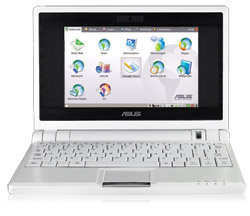
Seit etwa zehn Jahren Jahren plädiere ich für offene ICT-Systeme im Bildungsbereich, seien dies nun Computer, Netzwerke oder Plattformen (siehe z.B. meinen letzten Artikel "Offenheit aushalten lernen" (Biblionetz:t08000).
In persönlichen Gesprächen werde ich nach solchen Plädoyers des öftern mit einer Mischung aus Milde und Mitleid angelächelt: "Der Arme kennt eben die harte Realität des Lebens (noch) nicht, darum hat er so naive Idealvorstellungen. Spricht von Offenheit und Vertrauen; wenn der mal unsere Schülerinnen und Schüler / unsere Studierenden / unsere Mitarbeitenden erleben würde, dann wäre sein Vertrauen schnell aufgebraucht."
Verbal klingt das dann vielleicht etwa nach "Im von Dir genannten Umfeld mag das ja klappen, aber bei uns [wahlweise Schule, Schulstufe, Kanton, Land einsetzen] würde das nie funktionieren."
Bei diesem Totschlagargument ist dann auch meine bisherige, fünfjährige Erfahrung als Betreiber von mehreren Wikis auf verschiedenen Schulstufen in verschiedenen Kantonen und Ländern ohne Überzeugungskraft.
Hallo Beat, ich unterstütze deinen Ansatz zum Thema "offene" ICT Infrastruktur sehr. Möchte jedoch auf die problematische Definition von Vertrauen von Fredmund Malik aufmerksam machen. Das was Malik hier macht ist eine Umdefinition des Begriffes Vertrauen und der oben zitierte Watzlawick würde diese Definition als Doublebind bezeichnen. "Jederzeit erfahren, ab wann dein Vertrauen missbraucht wird", heisst nichts anderes als Überwachung und Überwachung und Vertrauen, lassen den Mitarbeiter (Student, Schüler, etc.) in einen emotionalen Doublebind gefangen. Jemand den ich überwache, dem Vertraue ich nicht. Was Malik mit seiner Aussage empfiehlt, ist die Mitarbeiter mit einer Doppelbotschaft "gefangen" zu halten. Ja, bei Schul-Wikis ist es so, dass man jederzeit feststellen kann, wenn jemand etwas ändert und was er ändert. Man hat also eine hohe Überwachung im System eingebaut. Das mag der Grund sein, dass du das Zitat von Malik beigezogen hast. Bin mir da aber nicht sicher inwieweit man hier Aussagen aus dem einen Bereich (Management) auf ein anderen Bereich (Kollaborative E-Learning Plattform) übernehmen kann/soll. Da was im auf einer kollaborativen E-Learning Plattform durchaus Sinn machen kann noch lange nicht als Managementstil zu empfehlen ist. Um etwas zur Diskussion beizutragen möchte ich die Frage stellen, ob Wiki gar kein Vertrauen braucht, da es nur wenig Motivation/Interesse gibt, etwas im Eigeninteressen destruktiv zu verändern (ich spreche jetzt explizit von Schul-Wikis und nicht von Wikis des Typs Wikipedia etc.). In Wiki sind keine Schulnoten und keine Prüfungen etc. zu finden. Der Aufwand/Ertrag Wiki für einen destruktiven Eigennutzen zu verwenden ist einfach zu gross. Vertrauen tritt ja erst dann auf wenn man Vertrauen auch missbrauchen kann, vorher braucht es gar kein Vertrauen. Vielleicht lässt sich daraus eine Aussage machen, dass man nicht von "offenen" ICT Systemen sondern von "minimal closed" oder "minimal controlled" Systemen spricht … das heisst, dass man nicht Systeme schliessen und schützen muss, wo es nichts oder wenig zu beschützen gibt oder der Aufwand/Ertrag für einen Missbrauch einfach zu gross ist. Eventuell helfen folgende 4 Kategorien weiter:
Vertrauen ist ganz offensichtlich eine Haltung, die man auf Verlangen weder von einem anderen erhalten, noch in sich hervorrufen kann.
sagten Paul Watzlawick, John H. Weakland und Richard Fisch bereits 1974.
Auf der gleichen Biblionetz-Seite (Biblionetz:w00321) steht aber noch ein weiteres Zitat zum Thema Vertrauen von jemandem, den man nicht als Softie oder Naivling mit Weltverbesserungsabsichten bezeichnen würde. Der St. Galler Management-Professor Fredmund Malik sagt im Kapitel Die Grundsätze wirksamer Führung seines Buches Führen - Leisten - Leben auf Seite 149
Vertraue jedem, soweit du nur kannst - und gehe dabei sehr weit, bis an die Grenze. Das ist die Grundlage und die Ausgangsbasis. Nun aber kommen vier wichtige Ergänzungen:
Es sind zwar nicht meine Mitarbeiter, aber nach diesem Prinzip funktionieren die von mir betreuten Wikis:
- Stelle jedoch sicher, dass Du jederzeit erfahren wirst, ab wann Dein Vertrauen missbraucht wird;
- stelle weiterhin sicher, dass Deine Mitarbeiter und Kollegen wissen, dass Du das erfahren wirst;
- stelle ferner sicher, dass jeder Vertrauensmissbrauch gravierende und unausweichliche Folgen hat;
- und stelle schließlich sicher, dass Deine Mitarbeiter auch das unmissverständlich zur Kenntnis nehmen.
Alle dürfen alles (bis an die Grenze: Auch auf der Startseite und den Wikieinstellungen). Das ist die Grundlage und die Ausgangsbasis. Nun aber kommen vier wichtige Ergänzungen:
Damit sollte klar sein, dass die Offenheit von Wikis und das den Nutzenden entgegen gebrachte Vertrauen nicht auf Naivität und Unkenntnis der Lage beruhen müssen. Offenheit und Vertrauen können auch sehr überlegt sein.
Nachtrag: Marc Pilloud (12.12.07) - Authentisierung, Versionsverwaltung und sonstige Mechanismen stellen sicher, dass ich gegebenenfalls jede Veränderung im Wiki feststellen, nachvollziehen und einer Person zuordnen kann.
- In den Einführungskursen weise ich bei der Erklärung von Versionsverwaltung und Notifikationsmechanismen (E-Mail und RSS) auch mit Absicht darauf hin, dass in einem Wiki keine Veränderung geheim bleibt.
- Neben den mir zur Verfügung stehenden Sanktionsmöglichkeiten habe ich gute Kontakte zu den jeweiligen Schulleitungen (die ich aber bisher nie wegen Wiki-Vandalismus nutzen musste...).
- Auch dies dürfte unter den Wikinutzenden bekannt sein.
Hallo Beat, ich unterstütze deinen Ansatz zum Thema "offene" ICT Infrastruktur sehr. Möchte jedoch auf die problematische Definition von Vertrauen von Fredmund Malik aufmerksam machen. Das was Malik hier macht ist eine Umdefinition des Begriffes Vertrauen und der oben zitierte Watzlawick würde diese Definition als Doublebind bezeichnen. "Jederzeit erfahren, ab wann dein Vertrauen missbraucht wird", heisst nichts anderes als Überwachung und Überwachung und Vertrauen, lassen den Mitarbeiter (Student, Schüler, etc.) in einen emotionalen Doublebind gefangen. Jemand den ich überwache, dem Vertraue ich nicht. Was Malik mit seiner Aussage empfiehlt, ist die Mitarbeiter mit einer Doppelbotschaft "gefangen" zu halten. Ja, bei Schul-Wikis ist es so, dass man jederzeit feststellen kann, wenn jemand etwas ändert und was er ändert. Man hat also eine hohe Überwachung im System eingebaut. Das mag der Grund sein, dass du das Zitat von Malik beigezogen hast. Bin mir da aber nicht sicher inwieweit man hier Aussagen aus dem einen Bereich (Management) auf ein anderen Bereich (Kollaborative E-Learning Plattform) übernehmen kann/soll. Da was im auf einer kollaborativen E-Learning Plattform durchaus Sinn machen kann noch lange nicht als Managementstil zu empfehlen ist. Um etwas zur Diskussion beizutragen möchte ich die Frage stellen, ob Wiki gar kein Vertrauen braucht, da es nur wenig Motivation/Interesse gibt, etwas im Eigeninteressen destruktiv zu verändern (ich spreche jetzt explizit von Schul-Wikis und nicht von Wikis des Typs Wikipedia etc.). In Wiki sind keine Schulnoten und keine Prüfungen etc. zu finden. Der Aufwand/Ertrag Wiki für einen destruktiven Eigennutzen zu verwenden ist einfach zu gross. Vertrauen tritt ja erst dann auf wenn man Vertrauen auch missbrauchen kann, vorher braucht es gar kein Vertrauen. Vielleicht lässt sich daraus eine Aussage machen, dass man nicht von "offenen" ICT Systemen sondern von "minimal closed" oder "minimal controlled" Systemen spricht … das heisst, dass man nicht Systeme schliessen und schützen muss, wo es nichts oder wenig zu beschützen gibt oder der Aufwand/Ertrag für einen Missbrauch einfach zu gross ist. Eventuell helfen folgende 4 Kategorien weiter:
- minimal geschlossen / minimal überwacht
- minimal geschlossen / maximal überwacht
- maximal geschlossen / minimal überwacht
- maximal geschlossen / maximal überwacht
Kontakt
- Beat Döbeli Honegger
- Plattenstrasse 80
- CH-8032 Zürich
- E-mail: beat@doebe.li
About me
Social Media
This page was cached on 21 Nov 2025 - 04:54.
