Schul-ICT
Schul-ICT Archive
- 1Nov 2020
- 1Sep 2020
- 1Jun 2017
- 1May 2016
- 1Nov 2015
- 1Oct 2015
- 1Sep 2015
- 1Jan 2015
- 2Oct 2014
- 1Sep 2014
- 1Aug 2014
- 4Jun 2014
- 2Mar 2014
- 1Feb 2014
- 1Dec 2013
- 1Nov 2013
- 2Oct 2013
- 5Aug 2013
- 2Jun 2013
- 1Feb 2013
- 2Jan 2013
- 2Dec 2012
- 1Oct 2012
- 1Sep 2012
- 1Aug 2012
- 2Jul 2012
- 1Jun 2012
- 1May 2012
- 1Apr 2012
- 2Mar 2012
- 1Feb 2012
- 2Jan 2012
- 3Dec 2011
- 2Nov 2011
- 4Sep 2011
- 1Aug 2011
- 2Jul 2011
- 3Jun 2011
- 1Mar 2011
- 2Jan 2011
- 2Oct 2010
- 1Sep 2010
- 1Jul 2010
- 2Apr 2010
- 2Mar 2010
- 5Feb 2010
- 2Jan 2010
- 1Nov 2009
- 1Sep 2009
- 1Jul 2009
- 2Jun 2009
- 2May 2009
- 3Apr 2009
- 1Mar 2009
- 1Jan 2009
- 3Mar 2008
- 2Feb 2008
- 1Jan 2008
- 1Dec 2007
- 1Nov 2007
- 1Oct 2007
- 1Sep 2007
- 2Aug 2007
- 6Jun 2007
- 4May 2007
- 1Apr 2007
- 1Mar 2007
- 8Feb 2007
- 3Jan 2007
- 5Dec 2006
- 3Nov 2006
- 1Oct 2006
- 2Sep 2006
- 3Aug 2006
- 4Jul 2006
- 6Mar 2006
- 1Dec 2005
- 1Jul 2005
Schul-ICT
 Die Universität Paderborn setzt mit der Aktion "Deine Universität in Deiner Tasche" ein starkes Signal, indem sie im kommenden Wintersemester alle StudienanfängerInnen mit einem kostenlosen Netbook ausstattet, das durch Sponsoren finanziert wird.
Damit macht die Universität Paderborn gleich mehrere Aussagen:
Die Universität Paderborn setzt mit der Aktion "Deine Universität in Deiner Tasche" ein starkes Signal, indem sie im kommenden Wintersemester alle StudienanfängerInnen mit einem kostenlosen Netbook ausstattet, das durch Sponsoren finanziert wird.
Damit macht die Universität Paderborn gleich mehrere Aussagen: - Für ein Studium braucht man heute einen mobilen Computer
- Netbooks eignen sich als mobile Computer fürs Studium, es muss kein grosser Notebook sein
- Der Support muss primär ein Computermodell kennen und supporten
- Die Chance, dass sich die Studierenden gegenseitig helfen können, ist viel grösser, als wenn alle Studierenden ein unterschiedliches Modell mit sich herumtragen
Im educaguide Infrastruktur von 2006 haben wir vor dem Einsatz von Thin Clients an Schulen mit hohen Multimedia-Anforderungen gewarnt:
In den Schulen insbesondere an Primarschulen ist das Bedürfnis nach Multimediaapplikationen gross. Weil zusätzlich Lernprogramme oft nicht für den Betrieb auf einem Thin Client System vorgesehen sind, eignet sich diese Technik nur beschränkt für den Einsatz in allgemein bildenden Schulen. Gegen deren Einsatz spricht insbesondere:
Seit dieser Aussage sind drei Jahre vergangen, die Technik hat sich weiter entwickelt. Wie sieht das heute aus? Suche ich im Netz nach Erfahrungen, so lese ich noch immer, dass z.B. Google Earth oder Microsoft Movie Maker auf Thin Clients nicht funktioniere oder das System zusammenbreche, wenn eine ganze Klasse versuche, Videos zu schauen. Zudem seien ältere, aber eben noch weit verbreitete Lernprogramme nicht thin-client-tauglich.
Frage an die Leserschaft: Gibt es aktuelle Erfahrungen mit Thin Clients in der Primarschule / Grundschule (sei dies Windows, Citrix, Linux, LTSP, etc.)?
P.S.: Es geht mir bei dieser Frage nicht darum, ob Thin Clients die beste technische Lösung für Primarschulen sind (oder ob Netbooks, OLPC XO, o.ä. besser geeignet wären), sondern nur darum, ob sich die technischen Anforderungen von PRimarschulen damit zufriedenstellend decken lassen.
- Anforderungen durch Multimediaprogramme: Bewegte Bilder und Töne überlasten den Terminal Server, die synchrone Übertragung von Bild und Ton ist nicht immer gewährleistet.
- Kein Anschluss für Multimediageräte: Scanner, Digitalkameras und Videokameras lassen sich nicht an Thin Clients anschliessen.
- Mangelnde Kompatibilität mit vielen Lernprogrammen: Verfügbare Lernprogramme werden in aller Regel nicht für Thin Client / Terminal Server Umgebungen entwickelt und funktionieren daher nicht in einem solchen Umfeld.
Am kantonalen ICT-Träff vom 29.04.2009 in Solothurn wurden erste Erfahrungen vom Schuleinsatz des Lernsticks präsentiert.
Beim Lernstick handelt es sich um einen bootbaren USB-Stick, auf welchem sich ein komplettes Linux befindet, ergänzt mit schulspezifischen Lernprogrammen. Der Computer wird komplett ab USB-Stick gestartet, benötigt also keine lokale Software (auch kein Betriebssystem) auf dem Computer. Damit unterscheidet sich der Lernstick von ähnlichen, für Schulzwecke konzipierte USB-Sticks, wie z.B. die Digitale Schultasche von Bayern, die auf ein lokal vorhandenes Betriebssystem (meist Windows) aufbauen.
Als Vorteile des Lernsticks nennen die Entwickler: 
Auch wenn man ohne den gesprochenen Text (ich war nicht an der Veranstaltung) nicht alle Informationen aus den Folien  lesen kann (insbesondere bei Folien 2-5
lesen kann (insbesondere bei Folien 2-5  ), finden sich interessante Aussagen:
), finden sich interessante Aussagen:
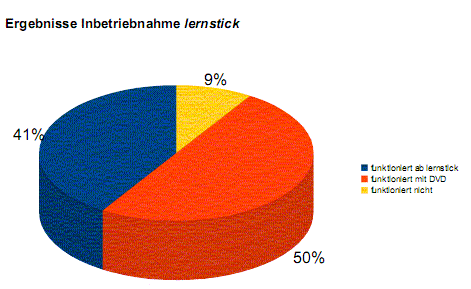
Zumindest in der Pilotklasse funktionierte der Lernstick auf weniger als der Hälfte der Heimcomputer der Schulkinder als USB-Stick, bei 50% funktionierte er nur als (nicht-beschreibbare) DVD, in 9% funktionierte er gar nicht. (Update: Siehe Kommentare: DVD heisst booten ab DVD, danach weiterarbeiten mit Lernstick).
Dies ist kein Vorwurf an den Lernstick, sondern für mich die simple Bestätigung, dass Schul-ICT komplex ist und in jedem Fall Support-Aufwand generiert. Darauf deutet auch die Aussage "Erste Verwendung daheim (mit Hilfe des IT-Supporters)" auf Folie 2 hin.
Ob sich mit dem Lernstick der Supportaufwand im Vergleich zu anderen Ausstattungskonzepten wird senken lassen, muss erst noch geprüft werden. Solche Vergleiche sind aber nicht einfach, weil zu viele Faktoren den Supportaufwand beeinflussen. Klar ist für mich aber bereits jetzt: Auch Lernstick/Linux kommt nicht ohne Support aus.
Hoi Beat
Ich weiss nicht, ob ich dir als OLPCler jetzt "Schnee von gestern" erzähle, aber "sugar" läuft auch ab USB-Stick, bin gerade am testen.
-- Main.MarcWidmer - 01 May 2009
Hallo Beat
Kleine Korrektur: bei 50% der Schülern funktionierte der Start mit Hilfe der DVD (der Bootvorgang wird dann automatisch vom lernstick fortgesetzt, wenn dieser gesteckt ist und die DVD kann auch nach dem Booten wieder entnommen werden). Sind also immerhin 81%, die das System daheim sinnvoll einsetzen können.
Viele Grüsse
Ronny
-- Main.MarcWidmer - 01 May 2009
Hallo Marc,
ja, dass Sugar-Labs daran ist, die Sugar-Oberfläche unabhängig vom OLPC auch auf anderen Netbooks und Notebooks zum Laufen zu bringen, wusste ich bereits. Zeit zum Selber testen habe ich jedoch bisher keine gefunden. -- Main.BeatDoebeli - 01 May 2009 Hoi Ronny,
Danke für die Info. Dann sind es aber 91% oder? -- Main.BeatDoebeli - 01 May 2009
-- Main.BeatDoebeli - 01 May 2009
- Massiv geringerer Wartungsaufwand (u.a. dank nicht notwendiger Userverwaltung)
- Verwendbarkeit von älterer und heterogener Hardware
- Keine Lizenzgebühren dank Verwendung von Open Source Software
- Identische digitale Lernumgebung (PLE...) sowohl in der Schule als auch zuhause

 lesen kann (insbesondere bei Folien 2-5
lesen kann (insbesondere bei Folien 2-5 - OpenOffice ist kein Problem
- Spiele sind ein Problem!
- Kinder setzen sich mit Lernprogrammen auseinander, die nicht zum Stoffplan der 5. Klasse gehören
- Begonnene Arbeiten werden (freiwillig) zu Hause weitergeführt
- Keine devianten Nutzungsmuster
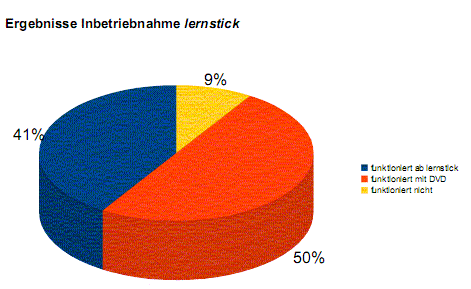
ja, dass Sugar-Labs daran ist, die Sugar-Oberfläche unabhängig vom OLPC auch auf anderen Netbooks und Notebooks zum Laufen zu bringen, wusste ich bereits. Zeit zum Selber testen habe ich jedoch bisher keine gefunden. -- Main.BeatDoebeli - 01 May 2009 Hoi Ronny,
Danke für die Info. Dann sind es aber 91% oder?
Wer austeilt, muss auch einstecken können: In der Tagungsdokumentation zum Münchenwiler SATW-Workshop ICT & School Organisation (Biblionetz:b03614) wird der 2006 erschienene educaguide Infrastruktur (Biblionetz:b03000) als veraltet bezeichnet:
Der educaguide Infrastrukutur ist schon einige Jahre
alt. Er wird in der Praxis nicht mehr als Referenzrahmen
gebraucht. Dies vor allem aus dem Grund, weil die
Empfehlungen zu hohe Investitionskosten und
wiederkehrende Kosten für die Schulgemeinden generieren.
Meiner Meinung nach ist diese Kritik nicht sehr stichhaltig: - Einerseits richtet sie sich nur gegen den Kostenrechner im educaguide. Dies ist aber nur ein Element in einem grösseren Rahmen, dessen Inhalte meiner Ansicht nach noch immer gültig und relevant sind.
- Des weiteren lassen sich im Kostenrechner die Höhe der einzelnen Elemente anpassen. Wer also der Meinung ist, dass ein mobiles Arbeitsgerät für die Schule in der Beschaffung inkl. Erstinstallation nicht mehr CHF 2500.- kostet, der passt einfach den entsprechenden Betrag im Kostenrechner an. Dafür muss der educaGuide nicht neu geschrieben werden.
- Die Kritik, dass unsere Zahlen zu hoch gegriffen sind, begleitet mich nun seit 10 Jahren. Dabei sind es meist die Geldgeber (Politik, Behörden), welche die Zahlen kritisieren und die Praktiker vor Ort, welche die Zahlen bestätigen. Leider fehlen aktuelle Untersuchungen dazu. Interessant könnte in diesem Zusammenhang die 2008 publizierte Benchmarkingstudie von Andreas Breiter, Arne Fischer und Björn Eric Stolpmann sein: Planung, Analyse und Benchmarking der Gesamtausgaben von IT-Systemlösungen für die pädagogische Nutzung neuer Medien in Schulen (Biblionetz:b03586).
Wir empfehlen eine komplette Überarbeitung des educaguide Infrastruktur. Hierbei müssen konkrete Zahlen und vordefnierte IT-Lösungen durch ganzheitliche Szenarien ersetzt werden. Die neuen Empfehlungen sind eine Wegleitung
zur Standortbestimmung, Bedürfnisanalysen bis hin zu betriebswirtschaftlichen Kosten-Nutzen-Rechnungen und Return on Investment resp. Return on Education Rechnungen. Der educaguide muss so konzipiert sein, dass er zukünftig flexibel erweiterbar und anpassbar ist. Zurzeit ist er zu statisch.
Zur Flexibilität: Alle Autoren der educaguides haben bei der Erstellung für die Nutzung eines Wikis plädiert, was aber von Seiten des SFIB damals abgelehnt worden ist. Der educaguide Infrastruktur ist meines Wissens der einzige der Guides, der auf einem Wiki entwickelt und auch heute noch in Wikiform verfügbar ist.
Für eine gelegentliche Überarbeitung bzw. Neufassung von Empfehlungen in technischer und organisatorischer Hinsicht bin ich durchaus zu haben. Nur bin ich der Meinung, dass der educaguide noch nicht so veraltet ist, dass er bereits jetzt überarbeitet werden müsste. Was "ganzheitliche Szenarien" im Detail bedeuten ist mir noch nicht so klar, aber dass ich meine Zweifel an "Return on Education Rechnungen habe, weiss ich bereits.
Eigentlich hätte ich hier verkünden wollen, dass der Schulrat der Primarschule Goldau das iPhone-Projekt der Projektschule Goldau einstimmig bewilligt hat. Doch der Klassenlehrer der zukünftigen Projektklasse, Christian Neff, hat mir den Primeur weggeschnappt und dies bereits heute morgen im Projektschulblog verkündet.
Nicht dass mich das ärgern würde, im Gegenteil: Es macht Spass, so aktive Leute im Projekt zu haben, die einen auch mal rasch überholen  Wer sich somit für das iPhone-Projekt in Goldau interessiert, dem sei empfohlen, den Projektschulblog zu abonnieren. Dort sind die neuesten Infos vermutlich schneller als hier. Denn auch die zeitliche Koinzidenz zweier ungleicher Behördenentscheide wurde dort bereits heute morgen vermeldet...
,
Wer sich somit für das iPhone-Projekt in Goldau interessiert, dem sei empfohlen, den Projektschulblog zu abonnieren. Dort sind die neuesten Infos vermutlich schneller als hier. Denn auch die zeitliche Koinzidenz zweier ungleicher Behördenentscheide wurde dort bereits heute morgen vermeldet...
,
Kontakt
- Beat Döbeli Honegger
- Plattenstrasse 80
- CH-8032 Zürich
- E-mail: beat@doebe.li
About me
Social Media
This page was cached on 21 Nov 2025 - 03:25.
