Schul-ICT
Schul-ICT Archive
- 1Jan 2026
- 1Nov 2020
- 1Sep 2020
- 1Jun 2017
- 1May 2016
- 1Nov 2015
- 1Oct 2015
- 1Sep 2015
- 1Jan 2015
- 2Oct 2014
- 1Sep 2014
- 1Aug 2014
- 4Jun 2014
- 2Mar 2014
- 1Feb 2014
- 1Dec 2013
- 1Nov 2013
- 2Oct 2013
- 5Aug 2013
- 2Jun 2013
- 1Feb 2013
- 2Jan 2013
- 2Dec 2012
- 1Oct 2012
- 1Sep 2012
- 1Aug 2012
- 2Jul 2012
- 1Jun 2012
- 1May 2012
- 1Apr 2012
- 2Mar 2012
- 1Feb 2012
- 2Jan 2012
- 3Dec 2011
- 2Nov 2011
- 4Sep 2011
- 1Aug 2011
- 2Jul 2011
- 3Jun 2011
- 1Mar 2011
- 2Jan 2011
- 2Oct 2010
- 1Sep 2010
- 1Jul 2010
- 2Apr 2010
- 2Mar 2010
- 5Feb 2010
- 2Jan 2010
- 1Nov 2009
- 1Sep 2009
- 1Jul 2009
- 2Jun 2009
- 2May 2009
- 3Apr 2009
- 1Mar 2009
- 1Jan 2009
- 3Mar 2008
- 2Feb 2008
- 1Jan 2008
- 1Dec 2007
- 1Nov 2007
- 1Oct 2007
- 1Sep 2007
- 2Aug 2007
- 6Jun 2007
- 4May 2007
- 1Apr 2007
- 1Mar 2007
- 8Feb 2007
- 3Jan 2007
- 5Dec 2006
- 3Nov 2006
- 1Oct 2006
- 2Sep 2006
- 3Aug 2006
- 4Jul 2006
- 6Mar 2006
- 1Dec 2005
- 1Jul 2005
Schul-ICT

- Ort: Didacta 2014, Basel, Swisscom Arena (Halle 1, Stand C90)
- Zeit: 29.10.2014, 9:30 bis 10:30 ,
Wenn ein Lehrer oder eine Lehrerin mit dem Gedanken spielt Bring your own device (BYOD) (Biblionetz:w02286) auszuprobieren, so muss er wissen, wer in der Klasse was mitbringen würde. Schlägt man BYOD einer Schule vor, bekommt man oft als Antwort "Das würde bei uns nicht funktionieren, da würden viel zu wenige etwas mitbringen." - genauere Zahlen haben aber die wenigsten Schulleitungen. Die üblichen Mediennutzungsstudien unter Kindern und Jugendlichen in Deutschland und der Schweiz helfen auch nicht weiter - ihre Resultate, die mit einer Verzögerung von fast zwei Jahren publiziert werden, sind in diesem schnelllebigen Bereich rasch veraltet und berücksichtigen auch die lokalen Unterschiede nicht.
Mit unserem gestern am 5. Workshop Digitale Lerninfrastrukturen in Duisburg in einer Betaversion vorgestellten Umfrage-Tool http://byod-umfrage.de versuchen wir diese Lücke zu schliessen. Eine Lehrperson kann rasch eine Umfrage für ihre Klasse erstellen und durch die Schülerinnen und Schüler ausfüllen lassen, egal ob auf einem Notebook, Tablet oder Smartphone.

Befragt wird eigentlich folgendes Schema:

Die Auswertung liefert einerseits eine Aufschlüsselung nach Betriebssystemen, andererseits nach möglichen Nutzungsszenarien:

Wir hoffen, damit die Planung von BYOD an der Schule fördern zu können und sind gespannt auf Feedback!
http://byod-umfrage.de
Müsste man bei den Note-/Netbooks nicht auch noch nach Windows- und Mac-Geräten unterscheiden?
-- Main.AndiHeutschi - 26 Sep 2014
Und mit einer Erweiterung um 3 Schuljahre wäre das Tool auch auf der Sekundarstufe 1 nutzbar. Aber bereits so sehr hilfreich! Danke!
-- Main.AndiHeutschi - 26 Sep 2014
Ah, die Auswahl 1.-6. Klasse kommt in der Schülerumfrage nur, weil die Testklasse auf "altersdurchmischtes Lernen" gestellt ist/war. Normalerweise gibt die Lehrperson bei der Erstellung einer Umfrage an, in welcher Klasse die Kinder sind und diese müssen/können dann die Klassenstufe nicht mehr auswählen. Und diese Auswahl geht bis zur 13. Klasse.
-- Main.BeatDoebeli - 27 Sep 2014



Anlässlich der Abschlussveranstaltung des School IT Rhein Waal-Projekts findet am 25.09.2014 in Duisburg der 5. Workshop Digitale Lerninfrastrukturen statt. Bring your own device (BYOD) (Biblionetz:w02286) wird dabei ein zentrales Thema sein:
WS1: Ausstattungsalternativen (Leihlösungen, BYOD, 1:1, hybride Infrastrukturen)
Im Workshop werden unterschiedliche Ausstattungsvarianten vor dem Hintergrund schulischer Nutzung vorgestellt und diskutiert. WS2: Infrastrukturen sicher und offene WLAN-Lösungen für Schulen
Die im Projekt School IT Rhein Waal entwickelten Lösung für WLAN und Userverwaltung werden vorgestellt.
Leitung: Andreas Zboralski und Jens Trzaska, KRZN WS3: Kooperation von Schulen: Kommunale Schulentwicklung
In der Transfer-Phase haben vor allem auch Kommunen beschlossen, private Hardware in das schulische Lernen einzubeziehen. Hierzu müssen Schulen und Schulträger gemeinsame Wege gehen.
Leitung: Christoph Hopp, Gymnasium Straelen, Roger Rixfehren, Stadt Duisburg WS4: Medienintegration und Schulentwicklung: Welche Themen unterstützt IT?
Digitale Medien unterstützen das fachliche Lernen und bereiten auf ein Leben in einer von Medien geprägten Welt vor. Die Integration in den Unterricht wird unterstützt, wenn Medienarbeit und andere Themen der Schulentwicklung Hand in Hand gehen: Inklusion, individuelle Förderung, Schulinterne Curriculumsentwicklung
Leitung: Marc Lachman, Andreas Weber, Gymnasium in den Filder Benden, Moers, Karim Rahman, Walter Bader Realschule Xanten WS5: Das Kollegium mitnehmen: Rolle der Schulleitung, interne Austauschstrukturen
Neben den technischen Voraussetzungen sind für den Erfolg schulischen Lernens mit digitalen Medien die Unterstützung durch die Schulleitung und die schulinterne Kooperationsbereitschaft elementar. Die Schulleitungen der Pilotschulen berichten aus Ihren Erfahrungen
Leitung: Wilhelm Derichs, Gymnasium in den Filder Benden Moers, Regina Schneider, Walter Bader Realschule Xanten WS6: Peer-Education: Die Rolle der Schülerinnen und Schüler
Schülerinnen und Schüler können das Lernen mit digitalen Medien in vielfältiger Weise unterstützen. Sie können sich, um die Technik im Klassenzimmer und die Ausleihe kümmern, sie können Mitschülern Hilfe bei technischen Fragen geben und sie können Anleitungen geben für einen sicheren Umgang mit dem Internet und sozialen Netzwerken.
Leitung: Christian Hauk, Walter Bader Realschule Xanten, Jenny Müller, Chrsitan Becker-Andernahr, Gymnasium in den Filder Benden, Moers, Katja Pannen, Sekundarschule Straelen-Wachtendonk Update: Anmeldung (Quelle) ,
Programm
| 09:30 | Begrüßung - Prof. Dr. Michael Kerres, Universität Duisburg Essen - Sjaak Kamps, Euregio Rhein Waal - NN, Medienberatung NRW / Schulministerium NRW |
| 10:00 | Prof. Dr. Beat Döbeli Honegger, Christian Neff, Projektschule Goldau |
| 10:25 | Dr. Stefan Welling, Tablets am Gymnasium |
| 10:50 | Prof. Dr. Stefan Aufenanger, Tablet-Projekt Wiesbaden |
| 11:15 | Harmen Neidig: BYOD in the Netherlands |
| 11:40 | Richard Heinen, School IT Rhein Waal |
| 12:10 | Podiumsdiskussion |
| 12:45 | Mittagspause |
| 13:30 | Parallele Workshops |
| 14:30 | Kaffeepause |
| 14:45 | Workshop (Wiederholung) |
| 15:45 | Abschluss und Umtrunk |
Im Workshop werden unterschiedliche Ausstattungsvarianten vor dem Hintergrund schulischer Nutzung vorgestellt und diskutiert. WS2: Infrastrukturen sicher und offene WLAN-Lösungen für Schulen
Die im Projekt School IT Rhein Waal entwickelten Lösung für WLAN und Userverwaltung werden vorgestellt.
Leitung: Andreas Zboralski und Jens Trzaska, KRZN WS3: Kooperation von Schulen: Kommunale Schulentwicklung
In der Transfer-Phase haben vor allem auch Kommunen beschlossen, private Hardware in das schulische Lernen einzubeziehen. Hierzu müssen Schulen und Schulträger gemeinsame Wege gehen.
Leitung: Christoph Hopp, Gymnasium Straelen, Roger Rixfehren, Stadt Duisburg WS4: Medienintegration und Schulentwicklung: Welche Themen unterstützt IT?
Digitale Medien unterstützen das fachliche Lernen und bereiten auf ein Leben in einer von Medien geprägten Welt vor. Die Integration in den Unterricht wird unterstützt, wenn Medienarbeit und andere Themen der Schulentwicklung Hand in Hand gehen: Inklusion, individuelle Förderung, Schulinterne Curriculumsentwicklung
Leitung: Marc Lachman, Andreas Weber, Gymnasium in den Filder Benden, Moers, Karim Rahman, Walter Bader Realschule Xanten WS5: Das Kollegium mitnehmen: Rolle der Schulleitung, interne Austauschstrukturen
Neben den technischen Voraussetzungen sind für den Erfolg schulischen Lernens mit digitalen Medien die Unterstützung durch die Schulleitung und die schulinterne Kooperationsbereitschaft elementar. Die Schulleitungen der Pilotschulen berichten aus Ihren Erfahrungen
Leitung: Wilhelm Derichs, Gymnasium in den Filder Benden Moers, Regina Schneider, Walter Bader Realschule Xanten WS6: Peer-Education: Die Rolle der Schülerinnen und Schüler
Schülerinnen und Schüler können das Lernen mit digitalen Medien in vielfältiger Weise unterstützen. Sie können sich, um die Technik im Klassenzimmer und die Ausleihe kümmern, sie können Mitschülern Hilfe bei technischen Fragen geben und sie können Anleitungen geben für einen sicheren Umgang mit dem Internet und sozialen Netzwerken.
Leitung: Christian Hauk, Walter Bader Realschule Xanten, Jenny Müller, Chrsitan Becker-Andernahr, Gymnasium in den Filder Benden, Moers, Katja Pannen, Sekundarschule Straelen-Wachtendonk Update: Anmeldung (Quelle) ,
Relativ konsterniert liest sich das Editorial der aktuellen Ausgabe 14/2014 (Biblionetz:b05683) der Zeitschrift c't (Biblionetz:j00010) zum Schwerpunktthema Baustelle Schul-IT: 20 Jahre und kein Update
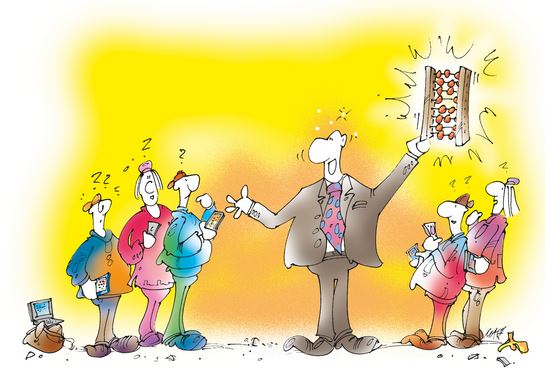
Dorothee Wiegand beklagt sich in diesem Editorial, dass in Deutschland das Kultusministerium seit Jahren (genauer: 1995) betont, wie wichtig digitale Medien für die Bildung seien, sich in der Schulpraxis aber vergleichsweise wenig bewege:
 Der Schwerpunkt enthält vier Artikel, die sich mit verschiedenen Aspekte von ICT in der Schule beschäftigen:
Der Schwerpunkt enthält vier Artikel, die sich mit verschiedenen Aspekte von ICT in der Schule beschäftigen:
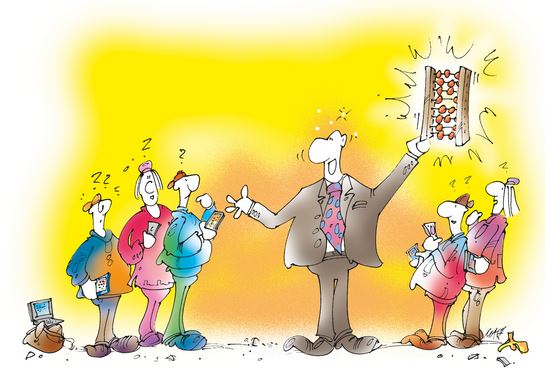
So gibt es keinen Zeitplan für die flächendeckende Ausstattung aller Schulen mit Breitbandanschlüssen. Es fehlt immer noch ein bundesweit gültiger Bildungsstandard, wie ihn die KMK für viele andere Fächer festgelegt hat. In der gymnasialen Oberstufe können Schüler mit Informatik nicht ihre Belegungsverpflichtung für die Naturwissenschaften erfüllen, denn Informatik ist den Fächern Biologie, Chemie und Physik nicht gleichgestellt.
 Der Schwerpunkt enthält vier Artikel, die sich mit verschiedenen Aspekte von ICT in der Schule beschäftigen:
Der Schwerpunkt enthält vier Artikel, die sich mit verschiedenen Aspekte von ICT in der Schule beschäftigen:
- Dorothee Wiegand Für das Leben Lernen - Schulen auf dem Weg zum zeitgemässen Computereinsatz
Seite 100-105 (Biblionetz:t16647) - Beat Döbeli Honegger, Jöran Muuß-Merholz Computer be-greifen! - Informatik-Unterricht ab der Grundschule
Seite 106-108 (Biblionetz:t16666) - Simon Peyton Jones, Jöran Muuß-Merholz "Computing" ab Klasse 1 - Interview mit Simon Peyton Jones
Seite 110-111 (Biblionetz:t16648) - Richard Heinen Handy erlaubt! - Smartphone & Co erobern das Klassenzimmer
Seite 112-115 (Biblionetz:t16649)
One-to-One-Computing (Biblionetz:w02173) beschreibt die Situation in höheren Schulstufen eigentlich bereits nicht mehr korrekt. Wenn die Schule das Mitbringen von persönlichen Geräten erlaubt, nehmen Studierende und SchülerInnen der Sekundarstufe II meist mehr als ein einziges Gerät mit. Neben dem Smartphone ist oft noch das Notebook oder das Tablet oder gar beides in der Mappe. Hochschulen rechnen bereits heute mit ca. 2.5 benötigten IP-Adressen pro StudentIn (und beklagen mangelnde IPV4-Adressen, wenn die Studierendengeräte "echte" IP-Adressen erhalten sollten).
Damit ist der Begriff One-to-One-Computing ja eigentlich veraltet. Ich verwende ihn aber weiterhin. Alle bisher gehörten Vorschläge für einen moderneren Begriff wie Many-to-One-Computing, Personal Learning Environment etc. sind mir zu schwammig und bringen den Paradigmenwechsel einer 1:1-Ausstattung aus meiner Sicht zu wenig prägnant auf den Punkt.
Für mich ist eine 1:1-Ausstattung ein Wendepunkt, ein singularity point. Bei einer 1:1-Ausstattung kippt die Situation, ab dann sind digitale Geräte verfügbar und wir können uns um inhaltliche und didaktische Fragen kümmern, statt logistische Herausforderungen zu lösen. So wie die Veränderungen von einer 1:6 zu einer 1:4-Ausstattung eher gradueller Natur sind (und mich bildungspolitisch seit längerem nicht mehr interessieren, obwohl es im Schulzimmer natürlich einen Unterschied macht), so sind es auch nur graduelle Unterschiede, ob Lernende 1.0, 1.5 oder 2.5 digitale Geräte zur Verfügung haben.
Das war schon früher so: Der Wendepunkt war, als alle Schülerinnen und Schüler einen Stift zum Schreiben hatten. Wie viele Farbstifte heute zur Verfügung stehen, ist irrelevant.
One-to-One-Computing ist für mich die technokratische Metapher für die Aussage "Liebe Schule, digitales Lernen und Arbeiten ist alltäglich."
One-to-One-Computing ist darum eine relevante bildungspolitische Forderung. Alles darüber hinaus sind dann wieder Detaildiskussionen, die von SpezialistInnen geführt werden sollen.
Kontakt
- Beat Döbeli Honegger
- Plattenstrasse 80
- CH-8032 Zürich
- E-mail: beat@doebe.li
About me
Social Media
This page was cached on 11 Feb 2026 - 08:04.
