Medienbericht
Medienbericht Archive
- 1Dec 2025
- 1Apr 2019
- 3Sep 2016
- 1Jan 2016
- 1Sep 2015
- 1May 2015
- 1Dec 2014
- 1Jun 2014
- 2Oct 2013
- 1Aug 2013
- 1Jul 2013
- 3Jun 2013
- 1Apr 2013
- 1Feb 2013
- 1Oct 2012
- 1Sep 2012
- 1Jul 2012
- 1Jan 2012
- 1Sep 2011
- 1Aug 2011
- 2Mar 2011
- 1Feb 2011
- 2Jan 2011
- 1Dec 2010
- 2Sep 2010
- 1Aug 2010
- 1Dec 2009
- 1Oct 2009
- 1Sep 2009
- 2Aug 2009
- 1Apr 2009
- 1Mar 2009
- 1Feb 2009
- 1Oct 2008
- 1Aug 2008
- 2Jun 2008
- 1Jan 2008
- 1Oct 2007
- 2Aug 2007
- 1Jun 2007
- 4May 2007
- 3Apr 2007
- 3Feb 2007
- 2Jan 2007
- 2Dec 2006
- 1Nov 2006
- 1Oct 2006
- 3Jul 2006
- 4Jan 2006
- 1Dec 2005
- 4Nov 2005
Medienbericht
Dänemark schafft die Post ab!
Wir sollten dem Beispiel folgen und zum Schutze der Kinder Papier verbieten!
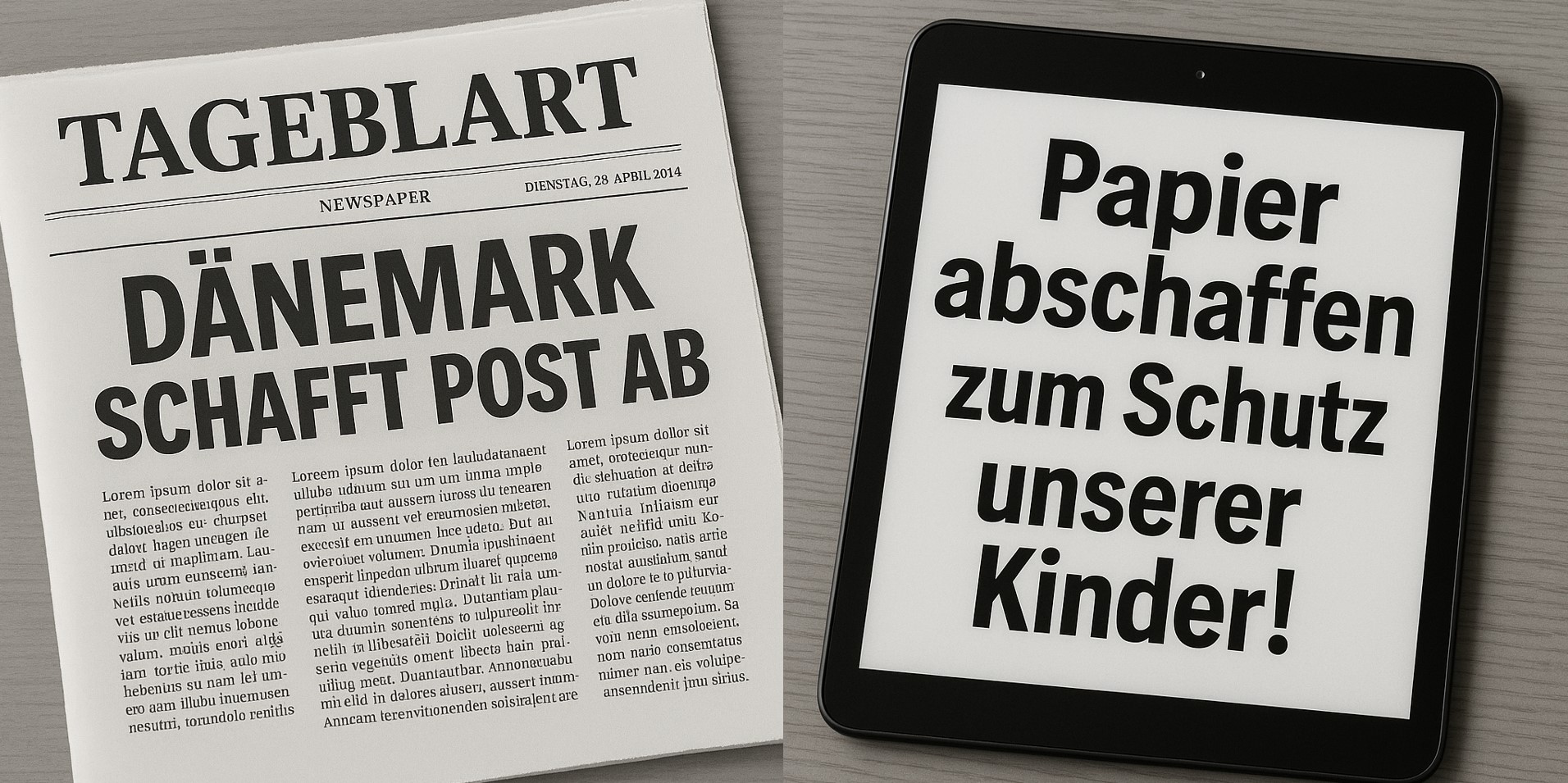
- Gewisse Medien pauschalisieren, was das Redaktionssystem hergibt.
- Gewisse Kreise stellen pauschale, vermeintlich klare und einfache Forderungen auf
- Begründet werden die Forderungen mit Argumenten, die oft auf massiven Generalisierungen beruhen oder gar nicht zur Forderung passen
Bereits in der 137. Folge der verkürzten Zitate war Andreas Schleicher (Biblionetz:p04057), OECD-Direktor für Bildung und verantwortlich für die PISA-Studien (Biblionetz:w01358) betroffen. So auch in der 138. Folge.
Teaching children coding is a waste of time, OECD chief says lautet der Titel eines Artikels aus dem Februar 2019 im Telegraph (Biblionetz:t24114) und fährt fort mit den Worten

Gemäss diesem Artikel soll Schleicher also der Meinung sein, Programmieren zu lernen sei eine Zeitverschwenung, weil diese Fertigkeit bald überflüssig sein werde. (Biblionetz:f00114)
Kritisiert Schleicher somit den Informatikunterricht als kurzlebig und damit überflüssig?
Teaching children coding is a waste of time, the OECDs education chief has said, as he predicts the skill will soon be obsolete.
Andreas Schleicher, director of education and skills at the Organisation for Economic Co-operation and Development, said that the skill is merely a technique of our times and will become irrelevant in the future.

Am 09.09.2016 ist mein Forumsbeitrag in der Zeitung Bote der Urschweiz erschienen (Biblionetz:t19000):


Die sitzen doch zu Hause schon
genug vor dem Bildschirm!», werden
einige denken, wenn sie von der
Einführung des Fachs «Medien und
Informatik» in der Volksschule oder der
Ausstattung aller Schülerinnen und
Schüler des Bezirks Schwyz mit persönlichen
Tablets hören. Damit liegen sie
gar nicht so falsch. Tatsächlich verbringen
Kinder und Jugendliche ausserhalb
der Schule viel Zeit mit digitalen
Medien das belegen zahlreiche Studien
und die Erfahrung vieler Eltern.
Dies spricht jedoch nicht dagegen, dass
digitale Medien auch ihren Platz in der
Schule erhalten im Gegenteil. Die
Allgegenwärtigkeit digitaler Medien sowohl
im Berufs- als auch im Privatleben
zeigt, wie wichtig dieser Themenbereich
geworden ist.
Autofahren lässt sich als isolierte
Fertigkeit innert kurzer Zeit gut
ausserhalb der Schule erlernen. Die
Bedienung eines Autos hat sich in den
letzten 50 Jahren nicht gross verändert,
und mit Autos kann man primär eines:
fahren. Digitale Medien, also Computer,
Tablets, Smartphones etc. sind dagegen
Universalwerkzeuge, deren Möglichkeiten
laufend zunehmen. Im Gegensatz
zum Auto genügt es nicht zu
wissen, auf welches Pedal man drücken
muss. Kinder und Jugendliche benötigen
ein vertieftes Verständnis der digitalen
Welt, um sich mündig in ihr
bewegen zu können.
Hier kann nur die Schule die Chancengerechtigkeit
gewährleisten. Wo, wenn nicht in der Schule, sollen
Kinder und Jugendliche lernen, mit
digitalen Medien vernünftig umzugehen?
Nur in der Schule werden alle
Schülerinnen und Schüler erreicht,
unabhängig von den Möglichkeiten der
Eltern, die erforderliche Medienbildung
zu übernehmen. So hat sich die Stimmung
an Elternabenden in den letzten
Jahren stark gewandelt. Die meisten
Eltern begrüssen es heute sehr, wenn
sie bei der anspruchsvollen Aufgabe
unterstützt werden, einen mündigen
und kritischen Umgang mit Medien zu
vermitteln. Die Schule kann auch ein
differenzierteres Bild von digitalen Medien
vermitteln. Während diese im
privaten Umfeld vorwiegend als Unterhaltungsgeräte
wahrgenommen werden,
kann die Schule dazu beitragen,
die Geräte auch als Werkzeug zum
Lernen und Arbeiten zu sehen und zu
verwenden. Die langjährigen Erfahrungen
an der Projektschule Goldau zeigen,
dass dies kein praxisferner Wunschtraum,
sondern eine durchaus realistische
Folge des gezielten Computereinsatzes
an der Schule sein kann.
Die sitzen doch zu Hause schon
genug vor dem Bildschirm!», ist
auch verbunden mit dem Vorurteil,
dass Schülerinnen und Schüler dauernd
vor digitalen Geräten sitzen würden,
sobald diese in der Schule verfügbar
sind. Auch da sprechen die Erfahrungen
der Projektschule Goldau eine
andere Sprache. Etwa 10 bis 15 Prozent
der Unterrichtszeit arbeiten die Schülerinnen
und Schüler mit den jederzeit
verfügbaren, persönlichen Digitalgeräten.
Weder der Sportunterricht, die
Schulreisen noch die allgemeine Bewegung
haben deswegen in der Projektschule
Goldau abgenommen. Eigentlich
nicht verwunderlich: Niemand
würde erwarten, dass die Wandtafel
dauernd genutzt wird, nur weil sie im
Schulzimmer hängt. Genutzt wird sie,
wenn es didaktisch sinnvoll ist. Bei den
digitalen Geräten müssen wir uns eine
ähnliche Gelassenheit erst angewöhnen.
Auch der erste Zwischenbericht
einer mehrjährigen Tabletstudie der
Pädagogischen Hochschule Schwyz
kann vielleicht die Gemüter etwas beruhigen.
Es hat sich gezeigt, dass Schülerinnen
und Schüler, die in der Schule
über ein persönliches Tablet verfügen,
deswegen zu Hause nicht häufiger
Computerspiele spielen.
Die Zeit des «entweder oder» ist
bei digitalen Medien in der Schule
definitiv vorbei. Es geht um ein
sinnvolles «sowohl als auch». Die
Schule steht vor der dreifachen Herausforderung,
mit, über und trotz digitaler
Medien zu unterrichten. Ich freue mich
darauf, auch die diese Woche eingetretenen
Erstsemestrigen an der Pädagogischen
Hochschule Schwyz auf diese
anspruchsvolle Aufgabe vorzubereiten!
Dr. Beat Döbeli Honegger ist Professor für Informatik- und Mediendidaktik an der Pädagogischen Hochschule Schwyz in Goldau. Im März dieses Jahres ist sein Buch «Mehr als 0 und 1 Schule in einer digitalisierten Welt» im hep-Verlag erschienen.
red. Im «Bote»-Forum schreiben regelmässig prominente Schwyzer. Sie sind in der Themenwahl frei und schreiben autonom. Der Inhalt des «Bote»-Forums kann, aber muss sich nicht mit der Redaktionshaltung decken.
 Unter dem Titel Ić bin kein Schweizer (Biblionetz:t19159) berichtet das Magazin des Tages-Anzeigers von Robert Mateić der sich gerne in der Schweiz einbürgern lassen möchte, dem die Behörden jedoch mitteilen, sein Nachname lasse sich nicht wie gewünscht als Mateić schreiben, da die entsprechende Verordnung das Zeichen ć nicht kenne. Der Artikel erklärt gegen Ende, dass eigentlich technische Gründe dafür den Ausschlag geben. Da man bei den Behörden noch nicht mit dem umfassenden Zeichensatz UTF-8 arbeitet, hat man sich früher für einen Teilzeichensatz entscheiden müssen und hat ISO 8859-15, den westeuropäischen Zeichensatz gewählt. Somit lassen sich alle westeuropäischen Namen problemlos im Schweizer Pass abbilden, nicht jedoch die osteuropäischen. Der Artikel schliesst mit der Frage, ob dies dem Artikel 8 der Schweizerischen Bundesverfassung widerspricht: "Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen der Herkunft, der Rasse, des Geschlechts, des Alters, der Sprache..."
Unter dem Titel Ić bin kein Schweizer (Biblionetz:t19159) berichtet das Magazin des Tages-Anzeigers von Robert Mateić der sich gerne in der Schweiz einbürgern lassen möchte, dem die Behörden jedoch mitteilen, sein Nachname lasse sich nicht wie gewünscht als Mateić schreiben, da die entsprechende Verordnung das Zeichen ć nicht kenne. Der Artikel erklärt gegen Ende, dass eigentlich technische Gründe dafür den Ausschlag geben. Da man bei den Behörden noch nicht mit dem umfassenden Zeichensatz UTF-8 arbeitet, hat man sich früher für einen Teilzeichensatz entscheiden müssen und hat ISO 8859-15, den westeuropäischen Zeichensatz gewählt. Somit lassen sich alle westeuropäischen Namen problemlos im Schweizer Pass abbilden, nicht jedoch die osteuropäischen. Der Artikel schliesst mit der Frage, ob dies dem Artikel 8 der Schweizerischen Bundesverfassung widerspricht: "Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen der Herkunft, der Rasse, des Geschlechts, des Alters, der Sprache..."
In der aktuellen FAZ vom 17.08.2016 spricht sich Adrian Lobe im Artikel Auf dem Lehrplan der Siliziumtalschule (Biblionetz:t19106) gegen das Programmieren als Teil der Allgemeinbildung (Biblionetz:f00114) aus:
Müssen wir jetzt alle programmieren lernen? Die IT-Giganten
lassen sich entsprechende Förderprogramme ganz schön was
kosten. Doch ihre Ziele sind eher ideologischer als praktischer
Natur.
Ich möchte seine Argumentationsweise nicht unwidersprochen lassen. So wie sich viele Diskussionen um Kinder und Computer entschärfen lassen, wenn man Computer durch Buch ersetzt, erscheinen viele Aussagen Lobes in einem anderen Licht, wenn man Informatik oder Programmieren durch Biologie oder Chemie ersetzt.
Kontakt
- Beat Döbeli Honegger
- Plattenstrasse 80
- CH-8032 Zürich
- E-mail: beat@doebe.li
About me
Social Media
This page was cached on 11 Jan 2026 - 17:52.
